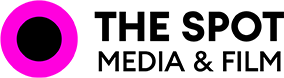„The Wire“-Fans wissen sofort, was Sache ist, wenn sie den Namen Uta Briesewitz hören. Sie trug als Kamerafrau maßgeblich dazu bei, mit dieser Serie ein Stück amerikanische Fernsehgeschichte mitzuschreiben. Längst ist sie als Regisseurin tätig, immer noch in Los Angeles zuhause. Ihren Aufenthalt in Deutschland nutzten wir, um mit ihr über ihre Lehrtätigkeit an der ifs Köln, aber auch allgemein über das Arbeiten in Hollywood und ihre Karriere zu sprechen.

Sie sind aktuell in Deutschland, als Gastdozentin im European Showrunner Programm (ESP) der ifs Internationale Filmschule Köln. Machen Sie das gerne?
Uta Briesewitz: Vorab möchte ich sagen, dass ich nicht nach Amerika gegangen bin, weil ich aus Deutschland weg wollte. Ich bin dort zum Studium ans American Film Institute in Los Angeles gegangen und dann einfach dort hängengeblieben. Zu einem, weil es mir dort so gut gefallen hat, und zum anderen, weil sich dort sehr schnell andere Möglichkeiten für mich ergaben. Ich habe immer die Verbindung nach Deutschland beibehalten, nicht zuletzt auch durch meine Familie und meinen Freundeskreis hier. Was hier in Deutschland in der Film- und Fernsehlandschaft passiert, hat mich immer interessiert. Als vor einiger Zeit die Anfrage der ifs kam, am European Showrunner Programm mitzuwirken, habe ich sofort „Ja“ gesagt. Mir machen diese Begegnungen und Austausche sehr viel Spaß. Das Interessante an dem ifs-Showrunner-Programm ist, dass es europaweit angelegt ist. Showrunner aus verschiedenen europäischen Ländern zu begegnen, sehe ich als eine außergewöhnliche Bereicherung für mich selbst.
Was vermitteln Sie da den Studierenden?
Uta Briesewitz: Ich bin in der Lage, den Teilnehmenden einen guten Einblick zu geben, wie das Prinzip des Showrunners in den USA läuft. Darum geht es ja. Das Modell des amerikanischen Showrunner-Prinzips findet nicht nur hier in Deutschland, sondern europaweit verstärkt Anklang und kommt erfolgreich zur Anwendung. Meine Lektionen konzentrieren sich oft darauf, wie die amerikanischen Showrunner extrem eng mit den Pilot-Regisseuren zusammenarbeiten, wenn eine neue Serie erstellt wird. Diese enge Zusammenarbeit gibt es generell nur während des Piloten.

Sie sind auch mit „Fellow Travelers“ präsent. Sie hatten diesbezüglich einen Talk im Filmforum des Museums Ludwig. Bei dieser Serie haben Sie zwei Folgen inszeniert. Was hat die Serie Ihrer Ansicht nach besonders gemacht? Und von anderen Eventserien abgehoben? Gestaltete sich auch für Sie die Arbeit anders als an anderen Serien?
Uta Briesewitz: Ich habe vorweg die Drehbücher bekommen, die ich ganz fantastisch fand. Darüber hinaus habe ich diese ganz persönliche und wunderschöne Email von dem Showrunner Ron Nyswaner bekommen. Danach war mir sofort klar, dass ich Teil dieser Serie sein musste und diese leidenschaftliche Liebesgeschichte erzählen wollte, die sich über vier Jahrzehnte hinweg spannt. Was mir beim Lesen der Drehbücher auffiel, war, dass die Sexszenen sehr graphisch beschrieben waren. Da ich wusste, dass Matt Bomer und Jonathan Bailey die beiden Hauptrollen spielen würden, war ich beeindruckt von dem Mut beider Schauspieler, diese Liebesszenen so ehrlich zu porträtieren. Matt und Jonathan spielen auch oft heterosexuelle Rollen und vor nicht allzu langer Zeit hätte ihnen diese Entscheidung in ihrer Karriere geschadet. Den Mut sich voll und ganz hinter diese Rollen zu stellen und darstellen zu wollen, wie zwei Männer sich leidenschaftlich lieben, ungefiltert, unzensiert, fand ich beeindruckend. Die Sexszenen folgten zwei bestimmten Regeln. Kein Sexakt sollte sich wiederholen, und jede Sexszene musste die Geschichte inhaltlich vorwärtsbringen. Es gab keine Sexszene, nur weil man Sex zeigen wollte. Es ist immer eine Reflektion gewesen, was das Powerplay der beiden Hauptcharaktere zum jeweiligen Zeitpunkt angeht. Diese Serie war für die meisten Beteiligten ein sehr persönliches Projekt, da viele der LGBTQIA+ Community angehören. Die Atmosphäre am Set war außergewöhnlich warm und herzlich.
„Michael Ballhaus war ein DP, zu dem ich immer aufblickte und dessen Karriere mich inspirierte.“
Können Sie etwas über Ihren frühen Werdegang in den USA erzählen und wie Sie es schafften, so kurz nach Ihrem AFI Studium als DP für „The Wire“ angeheuert zu werden?
Uta Briesewitz: Ich wollte immer in die Regie, habe damals an der dffb auch Regie studiert. Die Leidenschaft für das Visuelle, Bilder zu erschaffen und die Arbeit mit der Kamera hat mich immer begleitet. Als ich mich damals beim AFI beworben hatte, musste man eine Backup-Kategorie angeben. Meine erste Wahl war Regie, meine zweite Cinematography. Letztendlich hat mich das AFI für das Cinematography Programm angenommen. Im Nachhinein war ich dem AFI unglaublich dankbar, weil man als Kameramann sein Handwerk nach dem Studienabschluss sofort anbieten kann. Als Regisseur ist es nicht so einfach den Einstieg zu finden, vor allem, wenn man nicht selbst Drehbücher schreibt. Als DP war es für mich sehr schnell möglich, Job-Angebote zu bekommen. Ich hatte sogar noch vor meinem Abschluss am AFI meinen ersten Film als DP in Sundance, „Next Stop Wonderland“. Das war ein großer erster Erfolg für mich, der mir auch dabei half, mein Künstler-Visum zu bekommen, damit ich weiterhin in den Staaten bleiben und arbeiten konnte. Als ich später von Robert Colesberry für „The Wire“ angeheuert wurde, waren es mein zweiter Film mit Regisseur Brad Anderson, „Session 9“, und mein Demo-Reel, das ich als Studentin am AFI gemacht hatte, die mir diesen unglaublichen Job bescherten. Robert bezeichnete sich selber als jemand, der immer nach neuen Talenten Ausschau hielt, und irgendetwas sah er in mir. Er erzählte mir in unserem ersten Gespräch von seiner Arbeit mit Martin Scorsese und Michael Ballhaus bei „After Hours“. Die Tatsache, dass ich ein Meeting hatte mit einem Produzenten, der mit solchen Hollywood-Legenden gearbeitet hatte, war schon unglaublich. Ich selber bin ein großer Fan von beiden, vor allem Michael Ballhaus war ein DP, zu dem ich immer aufblickte und dessen Karriere mich inspirierte. Noch viel unglaublicher war es für mich, als ich den Job für „The Wire“ bekam. Robert muss sich sehr aus dem Fenster gelehnt haben, eine junge Frau für diese anspruchsvolle Serie anzuheuern, die alles andere als eine leichte Produktion war in einem harten Umfeld wie Baltimore. Darüber hinaus auch noch für HBO. Das war die Königsklasse, jeder wollte für HBO arbeiten. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, was für einen Impact „The Wire“ haben würde. Für mich war es der Job, der mir meinen ersten richtigen Paycheck gab, meinen Namen in dem Business bekannt machte und mir die berufliche Stabilität gab, in den Staaten eine Zukunft zu haben. Nun stand es endgültig fest, ich blieb.
Seit 2015 haben Sie die Kamera hinter sich gelassen. Warum?
Uta Briesewitz: In der Zeit, als ich als DP in Hollywood gearbeitet habe, gab es nicht sonderlich viele weibliche DPs. Wir waren eine Handvoll von DPs – Ellen Kuras, Amy Vincent, Nancy Schreiber -, die es schafften, auch für größere Produktionen in Erwägung gezogen zu werden. Mir gelang mein Einstieg zu Studio Features mit Jake Kasdans Komödie „Walk Hard -The Dewey Cox Story“, mit John C. Reilley. Mir wurde danach schnell bewusst, dass die Studios sich nur damit wohl fühlten, Frauen Komödien drehen zu lassen, aber alle anderen Genres fielen für uns so ziemlich unter den Tisch. Komödien alleine waren für mich auf Dauer nicht interessant genug. Ich hatte fast zwei Jahrzehnte in meine DP-Arbeit gesteckt und merkte, ich hatte einfach meine glass ceiling erreicht. Ich fühlte auch immer mehr den inneren Drang, jetzt endlich mit der Regie-Arbeit anzufangen. Endlich mit Schauspielern zu arbeiten, die ich all die Jahre so genau während meiner Kameraarbeit beobachten durfte. Mit der Geburt meiner zwei Kinder war es für mich auch einfach nicht mehr möglich, sechs Monate oder länger in eine andere Stadt zu ziehen, um eine Serie oder einen Studio-Film zu drehen. Bei der HBO-Serie „Hung“ bekam ich meine erste Chance, Regie zu führen. Diese Chance musste ich mir jedoch erkaufen. Meine Zusage, die Serie als DP zu drehen, gab mir das Versprechen, in der nächsten Staffel bei einer Episode Regie zu führen. Zum Glück wurde „Hung“ in den Paramount Studios in LA gedreht und ich konnte zu Hause bei meiner Familie bleiben, sonst hätte ich diesen Job auch nicht angenommen. Das war der Anfang meiner Regie-Arbeit. Die nächste Hürde war dann, bei einer Show als Regisseurin angeheuert zu werden, bei der ich nicht auch der DP war. Ich bekam viele Angebote, Serien zu drehen, und als Gegenleistung, die gesamte Serie zu drehen, baten mir Produzenten die Regie bei einer Episode an. Eine größere Serie zu drehen kann zwischen fünf und acht Monaten dauern, und zu dieser Zeit entstanden nur wenige Serien in Los Angeles. Ich hätte also sehr wahrscheinlich meine Familie für längere Zeiträume verlassen müssen. Die Regie bei einer Episode dauerte oft weniger als vier Wochen. Ich musste also ganz klar ansagen: entweder Regie oder gar nichts. Ich musste meiner Kameraarbeit bewusst den Rücken zukehren.

Sonst hätte man Sie als Regisseurin nicht ernstgenommen?
Uta Briesewitz: Genau! Ich bin sehr oft in meiner Karriere überrascht worden. Irgendwie konnte man nichts so richtig genau planen. Ich hatte auch immer die Einstellung, dass man nur so erfolgreich ist, wie andere Leute es einem erlauben, oder möglich machen. Letztendlich hängt man von seinem Team ab, denn in unserem Business arbeitet man nie alleine. Überraschenderweise bekam ich meine nächste Chance von Jenji Kohan, und zwar für die Regie bei der 100sten Episode von „Weeds“. Ich hatte nie etwas für sie als DP gedreht. Sie war aber auch dafür bekannt, Leuten in ihrem Team eine Chance in der Regie zu geben. Nach „Weeds“ heuerte sie mich an für die zweite Episode bei „Orange Is the New Black“. Jenny Snyder Urman ist eine weitere weibliche Showrunnerin, die mich bei ihrer Show „Jane The Virgin“ Regie führen ließ. Danach kamen Dinge so richtig ins Laufen für mich.
Vermissen Sie die Arbeit als Bildgestalterin?
Uta Briesewitz: Wenn man von der Kameraarbeit in die Regie wechselt, begegnet man oft dem Vorurteil, dass die sichere Führung der Bildgestaltung das einzige Talent ist, was man als Regisseur mit sich bringt. Die Kamera wird dadurch fast für uns Neulinge in der Regie zur Krücke. Ich wollte auf gar keinen Fall so beurteilt werden. Mein Interesse fokussierte sich von Anfang an sehr auf die Inszenierung, das Arbeiten mit den Schauspielern. Die Auflösung für die Kamera war leicht, ging schnell, und verlangte weniger von mir. Ich achtete immer darauf, meine DP-Kollegen nicht übermäßig zu kontrollieren, weil das oft auch ein Vorurteil war, dem ich begegnete. Ich musste mich ganz bewusst mehr zurücknehmen in diesem Aspekt meiner Arbeit. Ich hatte zwar immer genaue Vorstellungen, was ich machen wollte, habe aber Freiräume für meine kreativen Partner gelassen, sich einzubringen. Als DP hat man eine genaue Wahrnehmung, welche Lampe wo steht, welche Farbqualität sie hat, welche Stärke. Man muss auch ständig vorausdenken, was man als nächstes machen wird, um seiner Crew Anweisungen zu geben, effizient zu arbeiten. Diese technische Last nicht mehr detailliert mit mir zu tragen, fand ich geradezu befreiend. Dafür kamen aber andere Herausforderungen in meiner Regie-Arbeit, die diesen Platz schnell einnahmen. Als DP hatte ich am Ende des Tages immer diese ganz bestimmte Erfülltheit, Bilder erschaffen zu haben. Diese Art von Erfüllung erlebe ich als Regisseurin nicht mehr so stark, obwohl ich schon denke, dass ich bei der Bildgestaltung Anteil habe. Aber ich steuere eben nicht mehr die Kamera, ich halte die Kamera nicht mehr, ich fasse sie nicht an, ich sehe nicht mehr durch den Sucher und erlebe das Entstehen des Bildes nicht mehr durch die Kamera. Ich sehe das Bild an einem Monitor. Diese verlorenen Momente des kreativen Glücksempfindens sind jedoch durch andere, neue, ebenso aufregende Empfindungen ersetzt worden. Die Kameraarbeit ist eine große Liebe von mir, die ich zur Zeit etwas verlassen musste, etwas weniger die Hand anlegen darf, aber ich hoffe, dass SIE mich nicht verlässt. Natürlich hoffe ich, eines Tages zu ihr zurückzukehren und bei einem Film nicht nur Regie zu führen, sondern auch noch einmal die Kamera.

Betrachten Sie die Regie als eine Fortschreibung dessen, was Sie als DoP gemacht haben?
Uta Briesewitz: Absolut! Als DP muss man immer auch als Regisseur denken. Wie fängt man die Schauspieler am besten in dieser Szene ein, wie porträtiert man sie, um die Performance und die Szene selber zu unterstützen? Man wartet nicht unbedingt nur darauf, Anweisungen vom Regisseur zu bekommen, weil Regisseure sich unterschiedlich stark an der Bildgestaltung mit einbringen. Es ist generell aber eine sehr enge kreative Partnerschaft. Als DP – bei allem, was ich gemacht habe, mit Ausnahme von einem Job – habe ich immer auch die Kamera selbst geführt, ich war immer auch Operator. Das ist zwar nicht so in meinen Credits reflektiert, weil man laut US-Gewerkschaft diese Position des Camera Operators mit einem Operator besetzen musste. Das ist in den USA anders als in Deutschland, wo der DP normalerweise auch selber die Kamera führt. Für mich war es extrem wichtig, selber die Kamera zu führen, und das erforderte einen regelrechten Kampf auf meiner Seite. Die Produktionen mussten einen sogenannten Ghost Operator für mich anheuern. Jemand, der für den Job bezahlt wurde, damit wir den Union-Regeln folgten, der aber den Job nicht ausübte. Am Anfang sträubten sich viele Produzenten dagegen, aber wenn sie erstmal meine Arbeitsweise sahen, standen sie alle hinter dieser Entscheidung. Für mich war es immer wichtig, nah an den Schauspielern zu sein. Sie nahe zu sehen und zu spüren war das, was mich inspirierte wie ich die Kamera zu bewegen hatte, wie ich ausleuchten musste. Insofern habe ich eine lange Zeit einen frontrow seat gehabt, der mir ermöglichte, Performances von einer intimen Nähe aus zu beobachten. Und wie sich Performances während des Drehens veränderten, was den Schauspielern half und was sie allein ließ. Das war praktisch eine zusätzliche Schule für mich, jahrelang Schauspieler und Regisseure still zu beobachten. Die Kamera sollte immer dem Schauspieler dienen. Das habe ich jahrelang gemacht als DP, indem ich die Schauspieler mit Bildern eingefangen habe. Als Regisseurin habe ich jetzt die Möglichkeit, eine viel größere Welt bis ins letzte Detail zu steuern und die gemeinsame Suche nach der Performance anzuregen.
„Als Regisseurin motiviere ich die Leute meines Team immer, ihr Talent einzubringen.“
Wie würden Sie Ihr Selbstverständnis als Regisseurin beschreiben?
Uta Briesewitz: Ich stütze mich sehr auf mein Wissen aus der Kameraarbeit, aber als Regisseurin muss ich neue, zusätzliche Bereiche bedienen. Meine Arbeit als Regisseurin ermöglicht es mir, das Delegieren von vielen technischen Bereichen abzugeben. Ich muss zwar immer noch Teil der logistischen Maschine sein, aber das fällt mir aufgrund meiner Kameraarbeit leicht. Als Regisseurin motiviere ich die Leute meines Team immer, ihr Talent einzubringen. Mir ist es wichtig, meinen Kolleg:innen kreativen Freiraum zu geben und ermutige sie immer, sich einzubringen. Das heißt nicht, dass ich keine klare Vorstellung davon habe, wie ich Dinge haben möchte. Aber ich behalte immer einen offenen Geist, andere Interpretationen zu erkennen und zuzulassen. Ich wäre dumm, das Talent an meiner Seite nicht zu erkennen, zu nutzen und anzuspornen. Meine Arbeit erfüllt mich und macht mir unendlich Freude.
Sie haben fast ausschließlich bei Serien Regie geführt. Reizt Sie der Sprung ins Kinofach? Wie es beispielsweise Mat Shakman und Mark Mylod jüngst praktiziert haben?
Uta Briesewitz: Ich versuche, meine Karriere dahin zu steuern, dass ich Projekte aussuche, die mich wirklich interessieren. Und natürlich bin ich auch an Spielfilmen interessiert. Allerdings sind bisher noch nicht so reizvolle Drehbücher auf meinem Tisch gelandet. In Köln habe ich daher gerade meinen ersten Indiefilm gedreht. Natürlich hoffe ich, dass mich dadurch interessante Spielfilm-Drehbücher zukünftig erreichen werden. Sowohl Mark als auch Matt – mit beiden habe ich als DP gearbeitet – haben sich ihre Chancen, Filme zu drehen, durch ihre Fernsehserien erarbeitet. Mark war nach seinem Erfolg bei „Succession“ hoch im Kurs, dass er dadurch in der Lage war „The Menu“ für Searchlight zu machen. Beide haben größere Serien über sehr lange Zeiträume betreut. Diese Langzeitbetreuung wäre für mich nur möglich, wenn ich eine tolle Serie hier in LA finden könnte.

Was können Sie über Ihren Indiefilm erzählen?
Uta Briesewitz: Das Drehbuch heißt „American Sweatshop“ und stammt von Matthew Nemeth, einem Amerikaner. Erzählt wird die Geschichte von Daisy, die als ein sogenannter moderator bei einer Firma arbeitet, deren Mitarbeiter Videos anschauen müssen, die auf verschiedenen Social-Media-Plattformen als bedenklich gemeldet werden. Letztendlich sehen diese Menschen acht Stunden am Tag das Schlimmste, was das Internet zu bieten hat. Die Geschichte spielt in Florida, aber wir haben in Köln gedreht, dank der Hilfe unserer tollen deutschen Produzentin Anita Elsani, die uns innerhalb von fünf Monaten die Finanzierung aus Deutschland heraus aufgestellt hat. Es war uns nicht gelungen, die gesamte Finanzierung in den USA aufzutreiben. Die Story spielt viel in Innenräumen, und wir konnten Florida hier erstaunlich gut nachstellen. Die Hauptrolle spielt Lili Reinhart, die durch die US Serie „Riverdale“ bekannt ist. Zum Cast gehören u.a. Daniela Melchior („Road House“, „Fast X“), und Christiane Paul.
Wie genau verfolgen Sie aus Los Angeles, was sich in Deutschland im Film- und Fernsehbereich tut?
Uta Briesewitz: Natürlich gucke ich immer nach Europa und finde es spannend, was hier produziert wird, auch wenn es für mich in den USA manchmal schwierig ist, die Filme und Serien sehen zu können. Ich komme nicht an alles heran, v.a. was in Deutschland produziert wird. Das meiste kann ich nachholen, wenn ich von USA nach Deutschland fliege. Dann kann ich mir im Flugzeug elf Stunden lang deutsche Filme ansehen. Wenn mir Stoffe aus Deutschland geschickt werden, freue ich mich immer sehr und gucke sie mit großem Interesse an. Das Interesse, in meiner alten Heimat zu arbeiten, ist auf alle Fälle gegeben.
„Ich habe viele Jobs gemacht, ohne bezahlt zu werden – oder manchmal so wenig, dass ich es vorzog, nicht bezahlt zu werden.“
Bis heute wird Ihr Name primär im Zusammenhang mit „The Wire“ genannt, jene legendäre HBO Serie, an deren Unverkennbarkeit Sie beträchtlichen Anteil haben. War Ihnen schon damals bewusst, dass Sie epochales Fernsehen erschaffen?
Uta Briesewitz: Überhaupt nicht! Hätte mir jemand gesagt, dass diese Fernsehserie viele Jahre nach der ersten Ausstrahlung so viel Aufmerksamkeit bekommen würde, hätte ich das für Unsinn gehalten. Man muss sich vor Augen halten, dass in all den Jahren, in denen wir „The Wire“ gedreht haben, wir regelrecht von den Emmys in allen Kategorien ignoriert worden sind. Es gab später zwei Nominierungen für Drehbücher, aber das war alles. Ich habe eine oscarnominierte Freundin, die mir damals riet: „Uta, hör lieber auf ‚The Wire‘ zu drehen, dieser Job wird deine Karriere ruinieren.“ Es war eben Fernsehen! Aber ich dachte mir, ich mache lieber gutes Fernsehen als schlechte Indiefilme. Davon abgesehen, ging es für mich zu jenem Zeitpunkt auch ums Überleben. „The Wire“ war mein erster Job, bei dem ich richtig bezahlt wurde. Ich musste in Amerika von ganz unten anfangen. Ich habe viele Jobs gemacht, ohne bezahlt zu werden oder manchmal so wenig, dass ich es vorzog, nicht bezahlt zu werden. Man muss sich einen Namen erarbeiten und das kann schon eine Weile dauern. Man muss am Anfang bereit sein, ganz schön viel Arbeit reinzustecken und bescheiden zu leben.
Die Huldigung von „The Wire“ folgte später…
Uta Briesewitz: Nach Ausstrahlung ist „The Wire“ erst einmal verschwunden. Irgendwann kam die Serie auf DVD heraus, und mehrere Jahre später bekomme ich plötzlich großes Lob zugesprochen. Leute kommen auf mich zu, die ihre Begeisterung ausdrücken. Auf einmal war die Serie auf jeder Top-3-Liste der besten Serien aller Zeiten. Da wundert man sich schon. Was ist damals denn passiert? Haben damals alle dran vorbeigeguckt? Ich habe „The Wire“ verlassen, um mit den Russo Brüdern zu arbeiten. Sie bedrängten mich sehr, ihre neue Serie zu drehen, nachdem ich mit ihnen den Piloten in Texas gedreht hatte. Erst wollte ich nicht, aber sie waren sehr hartnäckig, und ich hatte im Gespür, dass sie es zu etwas bringen würden. Die Locations bei „The Wire“ änderten sich nicht viel. Ich wollte neue Umgebungen und Stile erkunden. „The Wire“-Schöpfer und Showrunner David Simon wollte mich dazu überreden zu bleiben, und sagte: „Uta, ich glaube, diese Serie wird Bedeutung haben, lange nachdem sie ausgestrahlt wurde.“ Ich dachte mir im Stillen: „Es ist Fernsehen, das kümmert niemanden nach der Ausstrahlung.“ Aber genau das ist passiert. Mehrere Jahre nach der Ausstrahlung fand die Serie weltweit große Aufmerksamkeit und dank ihr erhielt ich mehr Angebote.
Und zum Schluss die allerwichtigste Frage: warum zum Teufel sind Sie Fan von Bayer Leverkusen?
Uta Briesewitz: Das Bayer Leverkusen Logo alleine ist ein Stück Heimat für mich, da ich ja in Leverkusen geboren bin und dort aufwuchs. Als Jugendliche war ich Leichtathletin und habe das Logo viele Jahre lang getragen. Man kann fast sagen, das war ein Teil meiner jungen Identität in Leverkusen. Mein amerikanischer Mann hat mit viel Begeisterung die Spiele von Bayer Leverkusen verfolgt. Oft saß er bereits um 5 Uhr morgens vor dem Fernseher, um sie live zu sehen. Da habe ich dann oft mitgeschaut und die fantastische Spielweise dieses Teams hat mich mitgerissen. Ich gebe sogar zu, tears were shed als sie die Meisterschaft so rigoros gewonnen haben. Ja, ich bin ein Bayer Leverkusen Fan!
Das Gespräch führte Barbara Schuster