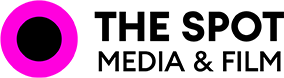Innovativer Stopmotion-Animationsfilm über ein Mädchen und einen indigenen Jungen, die im Dschungel von Borneo ein großes Abenteuer erleben.
FAST FACTS:
• Triumphaler Stop-Motion-Film vom Macher von „Mein Leben als Zucchini“
• Erste Arbeit von Claude Barras seit seiner Oscarnominierung
• Weltpremiere beim Festival de Cannes als Special Screening in der Reihe Cannes Premiere
• Triumphales Screening auf der Piazza Grande beim 77. Locarno Film Festival
CREDITS:
Land / Jahr: Schweiz, Frankreich, Belgien 2024; Laufzeit: 87 Minuten; Regie: Claude Barras; Drehbuch: Claude Barras, Catherine Paillé
REVIEW:
Ein erstes Bild nur, und man weiß, dass man einen Film von Claude Barras sieht, einen Stopmotion-Film, wohlgemerkt: die Mise-en-Scene, die Farben, die Figuren mit ihren runden Gesichtern, roten Nasen und ausdrucksstarken Augen und Mündern, geformt aus Ton. All das ist unverkennbar, so expressiv und innovativ, so liebevoll und obsessiv – eine Besessenheit, die man wohl mitbringen muss, wenn man diese Form des filmischen Ausdrucks wählt, die man in den letzten Jahrzehnten vor allem mit den Arbeiten von Aardman und Henry Selick verbindet. Nicht nur der Look ist es indes, der eine direkte Linie zieht zu dem Film, mit dem der Schweizer Filmemacher vor acht Jahren schlagartig berühmt geworden war, einen Europäischen Filmpreis gewinnen und eine Oscarnominierung erzielen konnte. Wie schon „Mein Leben als Zucchini“ erzählt auch „Sauvages“, noch ambitionierter in seinen Ansprüchen, noch aufwändiger und gewagter in seiner Machart, eine Geschichte, die aus Schmerz geboren ist.

Ging es in „Mein Leben als Zucchini“ um einen Jungen, der nach der Trennung von der Mutter in einem Pflegeheim erstmals Solidarität, Freundschaft und Liebe entdeckt, steht auch am Beginn von „Sauvages“ ein erschütternder Verlust: Eben noch spielt ein Orang-Utan-Baby mit seiner Mutter im Dschungel von Borneo, nährt sich an ihrer Brust, fühlt sich geborgen und geschützt vor den allgegenwärtigen Gefahren, die das Leben in der Wildnis mit sich bringt – um mit den Kollegen von Disney zu sprechen: the circle of life. Womit die Tiere nicht rechnen, sind die Menschen, die den Regenwald roden. Wenige Schüsse nur, und das schutzlose Tier ist eine Waise – Echos von „Bambi“, dessen Anfang es, wie man weiß, an purem Terror mit den schlimmsten Horrorfilmen aufnehmen kann.
Das Baby kann indes gerettet werden von dem Mädchen Kéria und seinem Vater, die in einer kleinen, evangelikalen Gemeinde am Rande einer Palmölplantage leben, allerdings in Einklang mit dem Rhythmus des Lebens in den ursprünglichen Tiefen Borneos, respektvoll den indigenen Menschen und Tieren gegenüber. Tatsächlich ist Kérias Mutter eine Eingeborene, allerdings lange schon gestorben, der Erzählung nach von einem Panther gerissen. Zeitgleich erhält diese kleine Familieneinheit Zuwachs durch Kérias Cousin Selaï, der von seiner Familie aus dem Dschungel in die Gemeindeschule („Jesus liebt dich“) geschickt wird, um dem Konflikt zwischen den ansässigen Nomaden und dem Holzfällerunternehmen zu entkommen. Sofort liegt Spannung in der Luft. Beschimpfte ihr Vater gerade noch die ungeschlachten Sicherheitsbeamten, die die Mutter des kleinen Affen, der auf den Namen Oshi getauft wird, als „Sauvages“, als „Wilde“, wird nun der kleine Selaï von den Freundinnen Kérias in der Schule auf diese Weise beschimpft. Es bedarf nur weniger Fehlschritte, und Kéria, Selaï und Oshi finden sich allein im Dschungel wieder, auf sich allein gestellt und konfrontiert mit einem Abenteuer, in dem wiederholt die Frage gestellt wird, wer die wahren Wilden sind.
Claude Barras erzählt die Geschichte in expressiven Bildern, mit satten Farben und einer unstillbaren Freude an der Gestaltung einer Welt, die vor dem Aussterben bedroht ist. Er erzählt es mit einer kindlichen Freude und durch die Augen von Kindern. In einem Statement beschreibt er es selbst am besten, wenn er sagt, er wolle sich im Rahmen einer sich rasend schnell verändernden Welt und kommenden und gehenden Generationen damit befassen, „wir trotz alledem Werte und ein Gefühl dafür weitergeben können, wohin wir uns bewegen“. Belustigt zeigt er die Widersprüche auf: der französische Vater, der die hektische westliche Welt hinter sich lassen will, der indigene Großvater, der ganz selbstverständlich ein Smartphone mit der Melodie von „Eye of the Tiger“ als Klingelton bei sich hat (ein guter Lacher!). Das wurde bereits in Cannes zurecht gefeiert, wo „Sauvages“ als Special Screening in der Reihe Cannes Premiere Weltpremiere hatte. Und jetzt auch in Locarno auf der restlos ausverkauften Piazza Grande, wo der Film eine doppelte Bedeutung hat: Hier funktioniert er auch als Schwesterfilm zu Pia Marais‘ „Transamazonia“, der eine ähnliche Kulisse wählt, um mit einer ganz anders gelagerten Geschichte etwas zu erzählen vom unstillbaren Hunger des Turbokapitalismus, der nach und nach die Existenz im Regenwald zu verschlingen droht.
Thomas Schultze