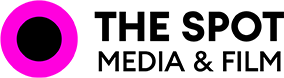Drama nach Romanvorlage von Russell Banks, in dem ein während des Vietnamkriegs nach Kanada geflohener Amerikaner seine Lebensgeschichte erzählt.

FAST FACTS:
• Erste Zusammenarbeit von Paul Schrader und Richard Gere seit „American Gigolo“ im Jahr 1980
• Paul Schraders zweite Verfilmung eines Romans von Russell Banks
• Erste Einladung von Paul Schrader nach Cannes seit 1988
CREDITS:
Land/ Jahr: USA 2024; Laufzeit: 91 Minuten; Regie, Drehbuch: Paul Schrader; Besetzung: Uma Thurman, Richard Gere, Jacob Elordi, Michael Imperioli, Kristin Forseth
REVIEW:
Es ist eine Weile her, dass Cannes eine Einladung an Paul Schrader ausgesprochen hat – zuletzt war er 1988 an der Croisette mit „Patty Hearst“, davor noch einmal 1985 mit „Mishima“. Eigentlich galt viele Jahre Venedig als sein bevorzugtes A-Festivals: Dort lief zuletzt seine neue God’s-Lonely-Men-Trilogie, die 2022 mit „Master Gardener“ ihren Abschluss fand. Hier lief 1997 auch seine erste Verfilmung eines Romans von Russell Banks, „Der Gejagte“. Die Adaption des letzten Romans von Banks, „Foregone“, 2021 erschienen und im Wissen um den nahenden Tod geschrieben, bringt Paul Schrader nun im Alter von 77 Jahren zurück nach Cannes – der Film ist dem im Januar 2023 gestorbenen Schriftsteller gewidmet.
Markierten die letzten drei Filme Schraders, „First Reformed“, „The Card Player“ und „Master Gardener“ eine Rückkehr zu alter Form nach einer langen Durststrecke, karge Porträts einsamer, im Krieg mit sich selbst befindlicher Männer, so waren sie auch Übungen in Schmucklosigkeit, in Enthaltsamkeit und Reduktion, Experimente, Film soweit auf seine Grundelemente herunterzubrechen, das nur noch ein Gerüst da ist, um eine Geschichte zu erzählen. „Oh, Canada“ ist nun auch wieder ein starker, ein sehr starker Film von Schrader, aber auch wieder ganz anders, eine Rückkehr wenn schon nicht zu Eleganz, so doch zu einer offeneren Form, fast schon verspielt für Schraders Verhältnisse mit dem ständigen Wechsel von Format und Filmmaterial, Farbe und Schwarzweiß, sehr impressionistisch, ein amerikanisches Fresko.
Das erste Bild von Richard Gere ist ein Schock, der Mann, der unter Paul Schraders Regie mit „American Gigolo“ 1980 nicht einfach nur zum Superstar wurde, sondern zu einem Inbegriff von männlicher Schönheit. 44 Jahre später sieht man ihn als Totenmaske, ein Mann, der, wie wir im Off hören, bereits gestorben ist, der den Kampf gegen den Krebs bereits verloren hat und in dem Moment, an dem der Film beginnt, kurz davor ist, ihn zu verlieren. Leonard Fife heißt die Figur, die er spielt, und ein Schwenk der Kamera über eine Wand mit Bildern und Urkunden verrät, dass er in Kanada ein gefeierter Dokumentarfilmer war. Nun werden Kameras und anderes Filmequipment aus ihren Cases geladen und sorgfältig aufgebaut. Zwei ehemalige Filmschüler Fifes, selbst bereits Oscar-prämiert und seinerzeit in der selben Filmklasse wie Fifes jetzige Ehefrau, gespielt von Uma Thurman, wollen ihm zu Ehren einen Film in seinem Stil drehen, ein Porträt, in dem er die Wahrheit erzählen will über seine Flucht von den USA nach Kanada als Fahnenflüchtiger im Jahr 1968.
Was beginnt, ist ein Spiel mit Perspektiven und Zeitsprüngen. Mal wird der junge Leonard Fife, der seine schwangere Frau und ihren kleinen Sohn sitzenlässt, als er nicht nach Vermont fährt wie verabredet, wo er ein Häuschen für die Familie kaufen wollte, sondern eben Richtung nördliches Nachbarland verschwindet und ein neues Leben beginnt, von dem schwer angesagten Jacob Elordi aus „Priscilla“ und „Saltburn“ gespielt, mal von Richard Gere selbst. Weil Leonard ein unzuverlässiger Erzähler ist, der zwar die Wahrheit beichten will in Gegenwart seiner Frau, aber eben auch unter dem Einfluss von Medikamenten, zunehmender Müdigkeit und seinem versagenden Körper steht.
Man weiß nicht genau, was er wirklich in die Kamera spricht, was er sich nur vorstellt, was wirklich stimmt und was nicht. So wird ein Gang durch den Spiegelsaal daraus, eine Meditation über die Wahrheit und das Sterben, über das, was verschwindet und was bleibt. Das ist so konzentriert und genau, dass 91 Minuten Spielzeit ausreichen. Weil es am Ende eben gar nicht so wichtig ist, was damals vorgefallen ist, auch wenn ein paar schockierende Wahrheiten ans Licht kommen, die den in der Öffentlichkeit gefeierten Mann in keinem guten Licht dastehen lassen. Sondern wie er selbst auf sich und sein Leben blickt. Und das ist immer wieder überragend, weil Richard Gere, selbst mittlerweile 74 Jahre alt so gut und konzis spielt, wie man es selten von ihm gesehen hat.
Thomas Schultze