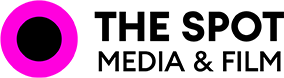Im Stil eines Anime realisiertes Prequel zu Peter Jacksons Realfilm-Trilogie, das 183 Jahre vor „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ angesiedelt ist und die Geschichte mit einer weiblichen Heldin neu erzählt.
FAST FACTS:
• Epischer Fantasy-Blockbuster mit Figuren des Mittelerde-Universums von J.R.R. Tolkien
• Aufwändige Animation im Manga-Stil des japanischen Regisseurs Kenji Kamiyama („Blade Runner: Black Lotus“, „Ghost in the Shell“)
• Peter Jackson zeichnet als ausführender Produzent verantwortlich
CREDITS:
O-Titel: The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim; Land/Jahr: USA/Japan 2024; Laufzeit: 134 Minuten; Drehbuch: Jeffrey Addiss, Will Matthews, Phoebe Gittins, Arty Papageorgiou; Regie: Kenji Kamiyama; Verleih: Warner Bros.; Start: 12. Dezember 2024
REVIEW:
J.R.R. Tolkien hat mit seinem Lebenswerk eine Fantasy-Vorlage geschaffen, die so vielschichtig und komplex ist, dass selbst Fußnoten Stoff für weitere Trilogien bieten. Es ist eine unendliche Geschichte mit einer unendlich großen Gemeinde von Hardcore-Fans, für die Mittelerde wohl auf ewig so aussehen wird wie in Peter Jacksons 17-fach Oscar-prämiertem Leinwandepos und die jede Abweichung kritisch verfolgen – wie zuletzt Amazons milliardenschwere Serienadaption „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“. Um all jene Kapitel der Legende zu erzählen, die im Kino bislang vernachlässigt wurden, versammelten allein die ersten beiden von fünf geplanten Staffeln 38 neue, diverse Stars vor der Kamera, über die nach dem Start im September 2022 ein beschämender, rassistischer Shitstorm hereinbrach. Dabei ist Tolkiens Universum nicht nur von Trollen bevölkert, sondern „per Definition multikulturell, eine Welt, in der sich freie Völker verschiedener Rassen und Kulturen in Gemeinschaft zusammenschließen, um die Mächte des Bösen zu besiegen“, verteidigten Showrunner und Schauspieler in einem Statement den woken Ansatz der Serie. „Der Herr der Ringe“ ist und war eben schon immer ein Politikum – und die sensationelle Fortführung des Franchise unter der Ägide des legendären japanischen Anime-Regisseurs Kenji Kamiyama nimmt nicht nur diesen Aspekt der Vorlage ernst.

„Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim“ ist zeitlich zwischen der Realfilm-Trilogie und der Amazon-Serie angesiedelt, zwei Jahrhunderte bevor der eine Ring am Finger des Hobbits Bilbo Beutlin ans Licht kam. „Zu dieser Zeit lebte ein Mädchen, das viele große Taten vollbracht hat, die bislang nicht erwähnt wurden“, beginnt die Erzählerinnenstimme, in der Originalversion ist es die von Miranda Otto, die unter Peter Jacksons Regie die Rolle der Éowyn innehatte, eine Nachfahrin einer Generation von Schildmaiden, die aus den Geschichtsbüchern beinahe ausradiert wurde. Das Prequel führt zurück in die Vergangenheit, knüpft stilistisch an die Wurzeln des Franchise an, an die Animationsfilme von Ralph Bakshi („Der Herr der Ringe“ von 1978) und Arthur Rankin und Jules Bass („The Return of the King“ von 1980), beruft sich darauf, dass Amazonen wie Éowyn schon vor Jahrtausenden die entscheidenden Schlachten geschlagen haben, es offenbart, dass in Mittelerde schon immer ein feministischer Wind wehte, woran nur noch ein einziges Banner im Königssaal von Rohan, dem Land des Reitervolks der Rohirrim erinnert – und der wilde, ungezähmte, freiheitsliebende Spirit der Königstochter Héra.

Das Drama nimmt seinen Lauf, als deren Vater Helm Hammerhand mit der fürchterlich donnernden Stimme des Charakterschauspielers Brian Cox und einem einzigen Faustschlag den Herrscher des benachbarten Dunlands niederstreckt, weil dieser seinen Sohn Wulf mit Héra vermählen und so die Macht an sich reißen wollte. Weil Héra ohnehin weder an Männern noch daran interessiert ist, verheiratet zu werden, startet Wulf einen erbarmungslosen, auf Vernichtung ausgerichteten Rachefeldzug mitsamt einer Armee der Finsternis, maskierten Ork-Berserkern und schaurigen Olifanten. Héra wird entführt, kann sich mit Hilfe ihrer loyalen Sidekicks befreien, der klugen Lehrmeisterin Olwyn und dem tapferen, arg gebeutelten, Hobbit-ähnlichen Wächter Lief. Nachdem der König auf Angriff statt auf Verteidigung setzt und den Rat seiner Tochter ignoriert, die den Heerführer als Verräter entlarvt, sitzen die Rohirrim in der Falle, können sich in letzter Sekunde in die Fluchtburg Helms Klamm retten, wo sie fortan bei eisigem Schneetreiben und knappen Ressourcen vom Feind belagert werden. Während der König vor Kummer und Trauer auf dem Sterbebett dahinsiecht, liegt das Überleben seiner Familie und seiner Gefolgsleute in Héras Händen.

In den Anhängen von Tolkiens „Die Rückkehr des Königs“ wird die Rivalität zwischen Helm Hammerhand und den übelgesinnten Dunländern auf gerade einmal elf Seiten ausgebreitet, der Name der jüngsten Tochter gar nicht erwähnt. Die Vision der Autoren fügt sich dennoch nahtlos in das Universum des Schöpfers, berücksichtigt Feinheiten und Details der Buchvorlage, wie weibliche und auch alle anderen Figuren darin beschrieben werden (einschließlich ihrer Haar- und Hautfarben). Man braucht keine Vorkenntnisse, man muss kein Fan sein, um die Sensibilität und die Sorgfalt zu spüren, mit der das Drehbuch verfasst wurde, dessen felsenfestes Fundament sowohl dem Zeitgeist als auch weniger aufgeschlossenen Gesinnungen standhalten dürfte. Mit Hilfe einer Crew, die zum Teil bereits dem Kreativteam von Peter Jackson angehörte (u.a. Effekt-Spezialist Richard Taylor, die Tolkien-Illustratoren Alan Lee und John Howe, Drehbuchautorin Philippa Boyens, die hier als Produzentin mitverantwortlich zeichnet), vereint Regisseur Kenji Kamiyama auf allen Ebenen Vergangenheit und Zukunft, stattet neue Charaktere mit bekannten Wesenszügen aus, zollt den Superstars des Franchise Respekt, mit Cameo-Auftritten von Gollum und Saruman, für dessen Stimme auf Archivaufnahmen des verstorbenen Christopher Lee zurückgegriffen wurde. In den mit enormem Aufwand erschaffenen Bilderwelten bewegen sich handgezeichnete Manga-Geschöpfe in epochalen CGI-Fantasy-Kulissen, ein einzigartiger, ein kunstvoller, etwas gewöhnungsbedürftiger Geniestreich. Es ist der überwältigende Score von Stephen Gallagher (Sound Editor unter Howard Shore), der daraus in jedem Moment einen unverkennbaren „Herr der Ringe“-Film macht, obwohl Ring- und anderer Zauber in diesem Fall nur Randbemerkungen sind.

Ganz im Sinne von Peter Jackson, dessen Mega-Erfolgsreihe nicht nur auf bahnbrechenden Effekten und Spektakel beruht, sondern noch mehr auf den Figuren, überzeugen diese auch in Kamiyamas Inszenierung trotz des zweidimensionalen Manga-Charakters, indem sie vor allem durch ihre Beziehungen zueinander definiert werden – man schließt die Protagonistin in der Sekunde ins Herz, in der ihr jüngerer Bruder auf rührende Weise ein Loblied auf seiner mittelalterlichen Gitarre auf sie anstimmt. Der wohl gravierendste Unterschied zu den Romanen, in denen es einen klaren Kampf zwischen Gut und Böse gibt, besteht darin, dass Licht und Dunkel näher beieinander liegen, die meisten Rollen Grauzonen verkörpern, mit Ausnahme von „fetten und gefährlichen Männern, die einfach nicht genug kriegen können“. Es geht um Menschen, die gegen Menschen kämpfen, um das Unmenschliche, das in der menschlichen Welt geschieht, verbunden mit der Hoffnung, dass diejenigen, die moralisch zweifelhafte Entscheidungen treffen oder nur eigene Interessen verfolgen, zum Umdenken fähig sind. Wie Helm Hammerhand, der schließlich Seite an Seite mit seiner Tochter in den Krieg zieht – „Du könntest die Welt regieren“, lautet die späte Einsicht des Vaters. Als dessen Legende im dritten Akt buchstäblich in Stein gemeißelt ist, behauptet sich Héra in einem brutalen finalen Geschlechterkampf gegen den rachsüchtigen Wulf, der zu mehr Grausamkeiten fähig ist als eine ganze Ork-Armee, seine Truppe mit Fake-News manipuliert und vor einer Frau niemals Schwäche zeigen würde – selbst, wenn diese ihrem Gegner mit der Furchtlosigkeit von „Furiosa“ gegenübertritt.

Manche Sequenzen erinnern ebenso an die Realität wie an „Mad Max“, an klassische Western-Duelle, an den Dialogwitz eines Action-Blockbusters, die Tragik Shakespeares, die Intrigen von „Game of Thrones“ (die ein oder andere Wendung weniger hätte es womöglich auch getan), doch in allen schlägt das Herz der rotschopfigen Héra, einer Heldin wie aus einer Shojo-Manga-Serie, die die Ritterrüstung unter dem Brautkleid trägt, sich nach Ruhm und Abenteuer sehnt, Zusammenhalt, Mut und Empathie beschwört, eine kluge Diplomatin, die letztlich den großen Weißkopfseeadler um Hilfe bittet, um dessen Freundschaft sie sich in weiser Voraussicht gleich in der Anfangsszene bemüht. Das Drehbuch suggeriert sogar, dass ein friedliches Zusammenleben nur dann möglich wäre, wenn Frauen das Sagen hätten. Am Ende aber findet der Film, der an dieser Stelle auch Tolkien-Fans versöhnlich stimmen möchte, seinen Weg zurück zur Ausgangssituation, macht klar, dass die auf das Prequel folgenden Geschichten wieder von Männern erzählen, zukünftige Kriege von Männern geführt werden, weil auch im wahren Leben die Diplomatie leider selten gewinnt.
Corinna Götz