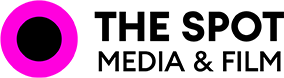In einer Woche kommt endlich „Emilia Pérez“ im Verleih von Neue Visionen / Wild Bunch in die deutschen Kinos, eines der großen Filmereignisse des Jahres, das in Cannes den Jurypreis und den Darstellerinnenpreis gewonnen hatte. Wir haben uns mit Regisseur Jacques Audiard über sein Meisterwerk unterhalten, das auch für die European Film Awards und die Oscars hoch gehandelt wird.

Es heißt, „Emilia Pérez“ sei ursprünglich als Oper geplant gewesen. Warum ist es dann doch ein Film geworden?
Jacques Audiard: Am Anfang hatte ich ein Libretto, für eine Oper. Das war der Plan. Und der Ausgangspunkt, aus dem sich alles weitere entwickelt hat. Mehr und mehr wurde schälte sich dann das Drehbuch für einen Film heraus. Die Oper habe ich dann bald abgehakt und mich auf den Stoff als neue Filmarbeit konzentriert. Ich hatte ihn genau vor Augen, aber es fehlte mir noch die nötige Verbindung zur Realität, also haben wir drei Reisen nach Mexiko unternommen und uns dort inspirieren lassen. Damit ging dann aber die Erkenntnis einher, dass die Realität, wie sie sich mir präsentierte, nicht geeignet war für den Film, den ich im Kopf hatte. Stilisierung war der einzige richtige Weg, eine leichte Verfremdung, Überhöhung. Und das ließ sich am besten mit einem Studiodreh bewerkstelligen. Wir haben „Emilia Pérez“ auf einer Studiobühne in einem Vorort von Paris gedreht. Er wurde im Grunde also wieder das, was ich von Anfang machen wollte, aber jetzt nicht mehr als Oper, sondern als Film.
Und als Musical. Allerdings als Musical, das sich nicht an die Konventionen des Genres gebunden fühlt. Wie sind Sie bei dieser Neuerfindung der Form vorgegangen?
Jacques Audiard: Das Musical ist ein mir eigentlich fremdes Genre. Es liegt mir nicht sonderlich, ich mag tatsächlich auch nur sehr wenige Musicals. Ich habe eine große Distanz dazu. Das war der Knackpunkt. Diese Distanz hat mir Freiheit gegeben, ich habe mich nicht an eine Form gebunden gefühlt. Am Anfang war es sehr schwierig, das Ganze mit dem Blick von oben zu betrachten, sich diese Anordnung als Ganzes vorzustellen. Aber jetzt, wo der Film fertig ist, kann man sagen, dass er durchaus meiner Vorstellung einer modernen Oper entspricht. Er hat die DNS einer Oper, ist von der Oper geprägt, den großen Gesten, den großen Gefühlen.

Wie haben Sie die Lieder erarbeitet, die Sie auf sehr ungewöhnliche Weise in den Handlungsfluss integriert haben?
Jacques Audiard: Wir hatten eine klare Vereinbarung getroffen, unsere Komponistin Camille Clément Ducol und mein Mitautor Thomas Bidegain. Die Lieder sollten immer eine Funktion erfüllen, die Handlung voranbringen. Sie durften den Film nicht aufhalten, sollten keinen Blick zurückwerfen und noch einmal etwas nacherzählen, was wir bereits gezeigt hatten. Sie spielen eine dramaturgische Rolle und bewegen die Geschichte nach vorn. Es war das erste Mal für uns alle, dass wir einen solchen Film gemacht haben. Sie könnten uns alle als Jungfrauen bezeichnen. Manchmal musste man etwas umschreiben. Im Grunde ist es so, dass sich die Handlung beschleunigt, dass es schneller geht, wenn man etwas mit Liedern erzählt. Es ist direkter, ohne Umschweife, bleibt besser hängen, verankert sich im Kopf. Sonst muss man eine Sequenz über fünf Seiten etablieren, man beschreibt die Situation, den Zustand, wie die Figur sich gerade fühlt. Musik ist da viel effizienter. Da ist es in drei Zeilen abgehandelt.
Aber da ist auch noch die begleitende Musik, die ebenso wichtig ist, weil sie dem Film seinen Puls gibt.
Jacques Audiard: Das sehen Sie richtig. Das gesamte Konstrukt der Musik ist sehr komplex, sehr ambitioniert. Oft genug haben wir auch den falschen Weg eingeschlagen und mussten dann wieder zurückgehen. Wir haben viel ausprobiert, experimentiert. Die gesungenen Passagen sollten das sein, was ich als die – in Anführungszeichen – „MEXIKANITÄT“ des Films bezeichnen würde. Das hat nicht funktioniert. Wir haben lange gebraucht, bis uns klar wurde, dass der Score – also die nicht gesungenen Musikpassagen – der rote Faden sind, der den Film zusammenhält, an dem sich der Film entlang entwickelt, der eine Verbindung darstellt. Die Lieder bringen einen in Kontrast in die musikalische Ebene. Das war auch ihre Aufgabe. Die Idee dahinter war, dass die Stimme immer im Vordergrund stehen musste, auch bei den nicht gesungenen Passagen. Das ist etwas, was wohl eher selten gemacht wird.

Ihr Film thematisiert die entmenschte Gewalt der Drogenkartelle in Mexiko. Sie gehen aber noch weiter, suchen tatsächlich nach Wege, wie sich diese Todesspirale durchbrechen lässt. Lag Ihnen die humanistische Botschaft am Herzen?
Jacques Audiard: Das war ein wichtiger Bestandteil des Projekts. Die Verwandlung von Emilia, ihre Transformation, spielt in diesem Zusammenhang die entscheidende Rolle. Der Film spielt in einem Land, in dem im Jahr 40.000 Menschen spurlos verschwinden, das gibt ihm natürlich eine politische Dimension. In diesem politischen Zusammenhang kann man „Emilia Pérez“ durchaus auch diskutieren. Ich lade dazu ein. Ich gebe kein Statement ab, ich sage nicht, dieses oder jenes muss gemacht werden. Ich bin Filmemacher, kein Politiker. Aber das Durchbrechen der Gewalt, die Rückkehr des Menschlichen sind natürlich die großen Themen. In einer Gesellschaft, die so sehr geprägt ist von Machismo, von ihren patriarchalischen Strukturen, von ihrer Gewalt, ist die Umwandlung des Geschlechts, das Bedürfnis, von einem Mann zu einer Frau zu werden, zumindest filmisch ein interessanter Lösungsansatz. Sicher ist es nicht DIE Lösung, aber vielleicht hilft es, einen anderen Blick auf die Problematik zu werfen.
Gleichzeitig erzählen Sie aber auch schon wieder vom Scheitern des Ansatzes.
Jacques Audiard: Emilia glaubt, Dinge wieder gutmachen zu können, einrenken zu können, Abbitte leisten zu können, in dem sie großherzige, wohltätige Dinge unternimmt. Sie hofft, die Welt ändern zu können – eine Welt, für die sie selbst mit die Verantwortung trägt. Aber das ist eine Illusion, eine Chimäre. Ich stelle aber schmunzelnd fest, dass Mexiko jetzt erstmals eine Präsidentin hat. Vielleicht bewegt sie ja etwas. Zumindest hoffe ich, dass es ein Symptom ist für eine Veränderung, einen Wandel.

In gewisser Weise thematisiert auch Ihr Film sich mit dem viel beschworenen „male gaze“, dem männlichen Blick.
Jacques Audiard: Ich kann darauf kaum antworten… Male gaze, female gaze, human gaze. Ich habe keine richtige Haltung dazu. Vielleicht müssen wir uns mehr ganz generell mit der Frage befassen, was die Funktion und Rolle von Kino ist. Das ist eine Frage, die mich interessiert und der ich gerne auf den Grund gehen würde. Da spielen dann gewiss auch der männliche und der weibliche Blick eine wichtige Rolle als Analyse-Instrumente. Es geht dabei doch um Fragen der Dominanz. Wer dominiert, wer wird dominiert. Welche Rolle spielt das Kino innerhalb dieser Parameter für die Dominierten? Vielleicht hat es gar keine Funktion für sie, vielleicht macht es sie auch nur dick und dumm. Damit sollte man sich beschäftigen.
Das Gespräch führte Thomas Schultze.