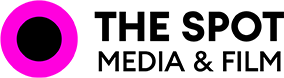Auf der Berlinale feierte Soleen Yusef mit ihrem neuen Film „Sieger sein“ eine rauschende Premiere als Eröffnungsfilm der Reihe „Generations K+“, jetzt kommt der Film bereits in die deutschen Kinos. SPOT sprach mit der Regisseurin über den weiten Weg zur Umsetzung und ihre ersten Erfahrungen als Botschafterin der German-Films-Kampagne „Face to Face“.

Als Sie die Idee zu „Sieger sein“ hatten, was für eine Art Film schwebte Ihnen da vor?
Soleen Yusef: Die Geschichte schlummerte schon lange in mir. Ich wollte immer einen Kinderfilm für die etwas anderen Kinder machen. Mir ging es dabei nicht per se um Kinder mit migrantischem Hintergrund oder geflüchtete Kinder, sondern um ein ganz bestimmtes Gefühl. Die Realität, die ich in „Sieger sein“ zeige, ist auch keine explizite Berliner Realität. Diese Konflikte existieren auch an Schulen in anderen Bundesländern. Mir haben Kinderfilme gefehlt, die auf Augenhöhe mit den Kindern erzählt werden, in denen es politische, gesellschaftliche und soziale Konflikte gibt, denen man nicht ausweicht, die auch zeigen, wie die Lehrkräfte kämpfen müssen. Ich erinnere mich, wie absurd es für mich damals war, als ich auf dieser anarchistischen Schule im Wedding gelandet bin, weil ich aus einem ganz anderen Schulsystem kam, Anfang bis Mitte der Neunzigerjahre im Irak, bevor der Teil Autonome Region Kurdistan hieß. Bei uns gab es noch Fahnenappelle, wir trugen Uniform, mussten der Direktorin jeden Morgen die Nägel zeigen. Waren sie schmutzig, gab es mit dem Lineal eins drauf. Im Wedding war ich dann baff, weil ich dachte: Mensch, das sind doch keine Lehrer. Das waren Sozialpädagog:innen, die mit konfliktreichen Situationen umgehen mussten, verbalen und körperlichen Ausrastern. Da habe ich gemerkt und verstanden, wie sehr Kinder hier respektiert und wahrgenommen werden, trotz des konfliktreichen Umfelds. Mit diesem Gefühl der Dankbarkeit, dass ich das Privileg hatte, einer anderen Bildungsinstitution zu begegnen, und des erstaunt Seins, dass die Lehrer:innen hier ganz normal mit den Kindern sprachen, nicht von oben herab, wollte ich diesen Film erzählen. „Sieger sein“ ist eine Hommage an meinen Grundschullehrer und an all die anderen Lehrkräfte, die mich so sehr geprägt haben, dass ich einen ganz anderen Lebensweg einschlagen konnte.
Wie realistisch war es, dass diese Geschichte tatsächlich einmal fürs Kino umsetzbar sein würde?
Soleen Yusef: Ich glaube einfach an meine Stoffe. Egal, wie lange es dauert sie umzusetzen. Eine Geschichte kann mehrere Jahre in mir schlummern, bis dann eine Art Silberstreif am Horizont auftaucht. Bei „Sieger sein“ war es die zufällige Begegnung mit meinem Lehrer von damals. Das war 2017, im S.O. 36 bei einer Benefizveranstaltung für die Frauen von Rojava. Er war in Frührente, nicht mehr im Schuldienst, hatte sich äußerlich überhaupt nicht verändert. Wir redeten den ganzen Abend über die Frauenrevolution in Nordsyrien. Kurz danach flog ich in meine Heimatstadt in Kurdistan. Da sprudelte die Geschichte einfach aus mir heraus. Ich habe sie aus der Ich-Perspektive erzählt, nicht von oben, sondern von innen, aus meinem inneren Kind heraus.
Zwischen Ihrem Kinodebüt „Haus ohne Dach“ und „Sieger sein“ waren Sie nicht untätig, haben zusammen mit ihrem Kameramann Stephan Burchardt viel Erfahrung mit der Umsetzung hochkarätiger Serien gesammelt. Hat Sie das als Regisseurin geprägt, verändert?
Soleen Yusef: Ich habe den Ehrgeiz, Filme zu machen, die einen gewissen Anspruch und eine politische Botschaft haben und trotzdem unterhaltsam sind. Ich glaube an diesen Spagat. Der Film entstand dank der Unterstützung der Initiative „Der besondere Kinderfilm“ mit einem ordentlichen Budget. Ohne dieses ordentliche Budget hätte ich meine Vision nicht umsetzen können. Ich glaube, man hat mir dieses Projekt in dieser Größenordnung nur zugetraut eben dank meiner großen Erfahrung mit Serien, die groß waren, universell erzählt, entertaining, eben immer umgesetzt zusammen mit Stephan… Ich erlebe meine Arbeiten fürs Fernsehen nicht als Ausflug, sondern als Erweiterung meiner Fähigkeiten, Genre auszuprobieren. Dieses Geld kriegt man für Kino oft gar nicht zusammen, diese Spielwiesen im Kino existieren bestenfalls für eine Handvoll von Leuten in Deutschland. Serien haben es möglich gemacht, dass auch junge Filmemacher ihre eigene Handschrift schärfen können. „Sieger sein“ wurde dank „Der besondere Kinderfilm“, aber auch dank meiner tollen Produzentinnen von DCM und unserem Herstellungsleiter Jan Brandt immer realistischer. Der Funke ist auf alle Beteiligten übergesprungen, und ich wusste, dass ich hier etwas in der Hand habe, das mit seiner Kraft ankommt. Ein Stoff braucht immer eine Kraft, die übergeht auf Leute.

Es sind einige Jahre verstrichen, bis das Projekt umgesetzt werden konnte. Hat sich der Film für Sie in dieser Zeit verändert?
Soleen Yusef: Nein. Er war im Kern schon immer so, immer witzig, persönlich und emotional. So echt, in den ersten Sätzen schon. Ich musste im Lauf der Zeit nur verstehen, dass ich aus einer ganz anderen Ecke des Erzählens komme, und hier nun an einem Kinderfilm schreibe, für Kinder erzähle. Dass ich eine andere Form von Erzählung finden musste für Krieg, für Sprache. Ich muss die Kinder, die sich meine Geschichte angucken, abholen, auf Augenhöhe. Sie sollen eine Sensibilität für Kinder entwickeln, die aus ihrer Heimat flüchten mussten, das heißt, der Geschichte eines geflüchteten Kindes, das Krieg erlebt hat, wollte ich auf jeden Fall treu bleiben. Und dennoch wollte ich die jungen Zuschauer nicht erschlagen. Sie sollen lachend und hoffnungsvoll aus dem Kino rausgehen.
Ihre Hauptfigur, Mona, hat eine ähnliche Vita wie Sie. Inwiefern basieren die anderen Kinder in der Klasse auf realen Personen, oder decken die eher auch Aspekte von Ihnen selbst ab?
Soleen Yusef: Die Kinder in der Klasse beruhen tatsächlich auf realen Menschen. Ich habe sie natürlich alle umbenannt. Die zwei Schwestern mit Kopftuch zum Beispiel gab es. Eine von ihnen war so talentiert beim Fußballspielen, dass ein Scout von Hertha sie für ein Sport-Gymnasium gewinnen wollte, was von der Mutter dann allerdings abgelehnt wurde. Mit Frauen und Fußball war man in den Neunzigerjahren noch nicht so weit… Terry beruht auf einem Mädchen, das immer sehr solidarisch war und sich immer um mich gekümmert hat als Außenseiterin in der Klasse. Ich habe eine so positive Erinnerung an sie, weil sie mich auch immer gepusht und mitgezogen hat. Es ist unglaublich, was ein einzelner Mensch für jemanden bedeuten und bewirken kann. Der Rest der Figuren ist ein Patchwork aus Freunden und aus Menschen, die mich beeindruckt haben.
Das Thema des Andersseins haben Sie aber auch noch anders aufgegriffen, in Gestalt der Figur des Lehrersohnes Harry.
Soleen Yusef: Ich hatte zwischendurch Angst, dass ich das überfrachte, weil ich alle und jeden bedienen wollte. Aber eine Klasse hat nun mal bis zu 27 Schüler:innen und die Zusammensetzung kann durchaus so aussehen. Ich hätte es unfair gefunden, jemanden auszuschließen. Ich sah mich bestätigt, als sich extrem viele Kinder für gerade diese Rolle gemeldet haben. Auch Kids im jungen Alter, die ihre Identitäten finden und genau dazwischen sind, sich auf der Suche nach ihrer eigenen sexuellen Orientierung befinden. Das hat mich also bestätigt, diese Figur mit zu erzählen, weil sich dadurch viele andere gesehen fühlen. Mona ist meine Tür und mein Tor in diese Welt, aber „Sieger sein“ ist keine Geschichte über ein geflüchtetes Kind. Es geht eigentlich um Außenseiter und Underdogs, um die etwas anderen Kinder mit den etwas anderen Lebenswegen und aus etwas anderen Umständen.

Wie war die Arbeit mit den jungen Darsteller:innen, von denen sicherlich die wenigsten schon Erfahrung vor der Kamera gesammelt haben? Welche Rolle spielt bei denen das Medium Film?
Soleen Yusef: Die Kinder haben nicht so große Berührungsängste mit Kameras wie unsere Generation. Sie haben ständig eine Kamera in der Hand, filmen sich, ihre Freunde, sind auf TikTok unterwegs und wünschen sich alle, die Stars von morgen zu werden. Es geht um Freiheit und Unabhängigkeit, kreatives Schöpfen. Alle Kinder waren extrem engagiert. Das Casting hat eineinhalb Jahre gedauert. Mir war die Konstellation sehr wichtig. Jedes Kind sollte durch eine Eigenart sichtbar werden. Im Laufe des Prozesses habe ich alle kennengelernt. Sie haben das Buch gelesen, wir haben es zusammen gelesen, ich habe ihre Ideen eingearbeitet, ein tolles Miteinander. Sie haben zu ihren Figuren Biografien geschrieben – ich hatte zwar eigene, wollte aber hören, was sie mitbringen. Das war rührend. Da floss ganz viel von ihnen mit rein, weil ich auch immer ein offenes Ohr für sie hatte und ihre Anliegen und Hinweise ernstgenommen habe. Ich sage immer: „Sieger sein“ ist nicht nur ein Film, es ist auch ein kulturelles Sozialprojekt. Es war großartig zu sehen, wie die Kinder an ihrer Aufgabe gewachsen sind. Mit Yvette Dankou hatte ich eine großartige Kinder-Coachin an meiner Seite, von der ich viel mitgenommen habe. Stephans und meine Art zu drehen, ist auch ein wenig speziell. Ich setze nie ab, drehe eine ganze Szene wie ein Theaterstück durch, was auch meinem wunderbaren Kameramann Stephan Burchardt zu verdanken ist, ohne den ich nicht arbeiten möchte. Dadurch entsteht kein Spiel, sondern die Kids konnten richtig reintauchen.
„Sieger sein“ war Eröffnungsfilm der Reihe Generation K+ der diesjährigen Berlinale. Wie war dieses Erlebnis?
Soleen Yusef: Großartig. Ich bin immer noch beseelt. Die Kinder grölen, klatschen mit. Wenn ein Tor fällt, war es, als wäre ein Tor für ihr Team gefallen. Das hat mich positiv gestimmt für die Kinoauswertung. Es war ein toller Start auf der Berlinale. Ich habe mir immer gewünscht, dass Eltern, Lehrer:innen, Sozialpädagog:innen und Kinder gleichermaßen glücklich und gerührt aus dem Kino rauskommen. Das ist eingetroffen.
Sie waren auf der Berlinale auch als Teil der Kampagne „Face to Face“ von German Films an Bord. Dadurch kommen Sie auch in Kontakt mit der internationalen Presse. Wie war Ihr Eindruck, wie werden deutsche Filmemacher:innen rezipiert?
Soleen Yusef: Die Kampagne geht ja erst richtig los, und ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ich bin beeindruckt von den beteiligten Kolleg:innen und freue mich, sie auf unserer Reise noch besser kennenzulernen. Ich habe das Gefühl, dass wir international viel mehr akzeptiert werden als innerhalb Deutschlands, wie auch die Debatte um Ilker Çatak zeigt. Ich bin aber positiv gestimmt, man muss Menschen manchmal einfach sensibilisieren. Allgemeingültige Aussagen kann ich ohnehin nicht machen, dafür treffe ich viel zu viele gute Journalist:innen, aber auch Filmemacher:innen, die eine ganz klare Vision von Deutschland, der Politik und der Filmlandschaft haben und mit denen ich mich gut verstehe. Aber es stimmt schon, es kommt schon unverändert oft vor, dass dein Name falsch geschrieben und ausgesprochen wird. Das ist anz schlimm, tut mehr weh, als man glauben mag. Vor allem, wenn man schon so lange in dieser Branche ist… Schmerzhaft ist auch, dass wir so wenig über unsere künstlerische Arbeit gefragt werden, sondern immer als wären wir politische Apparate, die irgendwas repräsentieren. Dabei will ich für das wahrgenommen, was ich mache. Vielleicht geht es mit „Sieger sein“ einen Schritt voran. Das wäre großartig.
Das Gespräch führten Barbara Schuster und Thomas Schultze.