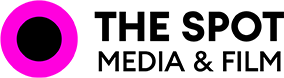In „Der Spitzname“ begleitet Sönke Wortmann zum dritten Mal die Familie Berger-Böttcher durch ein Minenfeld moderner verbaler Fettnäpfchen. Am 19. Dezember kommt der dritte Teil der erfolgreichen Komödienreihe im Verleih von Constantin Film Verleih in die Kinos. Wir haben schon mal beim Regisseur nachgefragt.

Zum ersten Mal in Ihrem Leben inszenieren Sie einen dritten Teil. Was gefällt Ihnen an der Prämisse, dass Sie immer wiederholt zurückkehren zur Familie Berger-Böttcher zurückkehren?
Sönke Wortmann: Ich mochte immer das Kammerspielartige. Als Regisseur gefällt mir in erster Linie die Arbeit mit Schauspielern und Schauspielerinnen. Ich hänge sehr am Text, suche nach Möglichkeiten, jede Zeile bis auf die letzte Zehntelsekunde auszuwringen, immer noch tiefer an die Essenz des Geschriebenen zu gehen. Bei einem solchen Genre bietet sich das an. Bei der Gesellschaftskomödie ist das eher möglich als bei einem Actionfilm, wo der Dialog nicht primär im Vordergrund steht. Das hat mir bei „Der Vorname“ bereits Spaß gemacht, und den Schauspielenden ging es genauso. Im Scherz haben wir zueinander gesagt: Wenn es ein Erfolg wird, dann machen wir einen zweiten Teil, und der heißt dann „Der Nachname“. Alle haben gelacht. Dann kam es wirklich dazu. Und auch da haben wir wieder im Scherz gesagt: Wenn das ein Erfolg wird, dann machen wir einen dritten Teil, und der heißt dann „Der Spitzname“. So richtig hat das keiner geglaubt, denke ich. Und jetzt sitzen wir hier und reden darüber.
Es war also keine Trilogie geplant, wie man das heute so macht?
Sönke Wortmann: Überhaupt nicht. Die Fortsetzungen fußen auf dem Spaß bei der Zusammenarbeit – und dem Zuspruch des Publikums. Mir bereitet das große Freude. Ich arbeite gerne mit dieser Gruppe von Schauspielern und Schauspielerinnen, weil ich mich bei ihnen genau auf das konzentrieren kann, was ich gerne mag: das reduzierte Arbeiten vor allem am Text.
Diesen Ansatz verfolgen Sie insgesamt in Ihren letzten Arbeiten, „Contra“ und „Eingeschlossene Gesellschaft“ eingeschlossen. Da spürt man ein Streben nach dem Essenziellen, einer klaren Genauigkeit, alles Überflüssige wird über Bord geworfen, steht nur im Weg.
Sönke Wortmann: Im Grunde entsteht das alles im Drehbuch. Ich bin da ein Vertreter der Billy-Wilder-Schule, die besagt, dass es bei einem Film drei wichtige Dinge gibt: Drehbuch, Drehbuch, Drehbuch. Da geben wir uns größte Mühe, der Autor, Claudius Pläging, sowieso und der Regisseur dann auch. Ich schreibe zwar selbst nicht, dafür ist der Autor einfach zu gut, aber ich begleite den Prozess dramaturgisch, mache Anmerkungen, gebe Anregungen. Der Vorteil ist, dass wir die schauspielenden Kollegen alle schon gut kennen und förmlich wissen, wie sie diesen oder jenen Satz wohl sprechen werden und wir uns bereits darauf freuen. Im nächsten Schritt treffen wir uns mit den Darstellern mehrfach, setzen uns nach Möglichkeit gemeinsam zusammen und gehen durch den Text, legen jeden noch so kleinen Halbsatz auf die Waagschale. Bis wir den Punkt erreicht haben, an dem alle einverstanden sind, das exakt so zu sprechen, wie es da steht.

Feilen Sie beim Dreh weiter?
Sönke Wortmann: Eigentlich nicht. Wenn diese Übereinkunft einmal besteht, wird nichts mehr oder kaum noch etwas geändert. Für mich funktioniert Komödie mit Improvisation eher nicht. Das entspricht nicht meiner Arbeitsweise und nicht meiner Überzeugung, was eine gute Komödie ausmacht. Ich bin ein eherner Verfechter des Prinzips: Beste Vorbereitung, danach keine Änderungen mehr.
Wie sind Sie an den dritten Teil herangegangen? Gibt es Vorgaben oder Ideen von Ihnen?
Sönke Wortmann: Die Produzenten treibt eine gewisse Euphorie, sie sind es, die auf einen dritten Teil gedrängt haben. Ich bin generell erst einmal skeptisch, habe eher Bedenken, ob es inhaltlich noch einmal weitergehen kann. Tatsächlich halte ich diese Zurückhaltung aufrecht, bis mir eine erste Drehbuchfassung von Claudius vorliegt. Es ist ein Genuss, seine Dialoge zu lesen. Aber tatsächlich lasse ich mein Gefühl entscheiden, ob ich den Film wirklich machen will. Damit bin ich immer gut gefahren. In diesem Fall war es so, dass sich das Gefühl im Grunde sofort wieder eingestellt hat. Oder zumindest sehr schnell. Hier hatte Claudius den klugen Einfall, zwei neue Figuren einzuführen, von denen in den ersten beiden Teilen nur geredet worden war. Dass sie jetzt wirklich auftauchen, ist ein guter Kniff, dem vertrauten Gefüge einen neuen Dreh zu geben, frischen Wind in die Sache zu bringen.
Weil es ja auch die Positionen des bereits bekannten Ensembles verändert.
Sönke Wortmann: Wenn man zwei jüngere Figuren an Bord bringt, werden automatisch andere Themen verhandelt. Auf einmal reden wir mit einem veränderten Blick darüber. Wenn man in seinem Film über das Gendern oder Pronomen spricht, geht das nur, wenn auch Vertreter der entsprechenden Generation argumentieren.

Der neue Schauplatz in Osttirol ist ein weiterer veränderter Aspekt.
Sönke Wortmann: Das ist aus einem anderen Grund geboren, als man vielleicht glauben mag. Unsere Darstellenden sind allesamt vielbeschäftigt. Und als wir ihre Terminpläne übereinandergelegt haben, ergab sich, dass es nur im Februar und März möglich sein würde, sie gemeinsam vor die Kamera zu holen. Aus diesem simplen Grund wurde es ein Winterfilm. Dann auf die Idee zu kommen, die Handlung in ein Skigebiet zu verlegen, war ziemlich nahelegend. Dass es Osttirol und nicht Südtirol wurde, hatte aber wohl tatsächlich etwas mit der Förderung zu tun.
Wenn man Ihre mittlerweile doch sehr üppige Filmographie durchgeht, stellt man fest, dass die Zäsuren in Ihrer Karriere grob in Zehn-Jahres-Schritten erfolgen: „Der bewegte Mann“ 1994, „Das Wunder von Bern“ 2003, „Frau Müller muss weg“ 2015. Haben Sie den Eindruck, dass Sie auch jetzt wieder ein neues Kapitel aufschlagen wollen?
Sönke Wortmann: Erst einmal muss ich sagen, dass ich mit unverändertem Staunen auf meine Karriere blicke. Ich hätte mir das alles niemals träumen lassen. Was ich alles machen durfte! Diese großen Projekte wie „Die Päpstin“ haben mir viel Freude bereitet. Aber es stimmt schon, ich war dann irgendwann an einem Punkt angelangt, wo mir die Reduktion gefiel, meine Arbeit wieder auf das Wesentliche zurückzuführen, nicht immer noch größer zu werden und größere Risiken einzugehen, sondern an der Genauigkeit zu arbeiten, immer noch präziser zu werden. Dass es ab „Frau Müller muss weg“ dann kleinere Geschichten waren, habe ich nie als problematisch empfunden. Es war genau das, was ich wollte. Natürlich denke ich nicht in Zehn-Jahres-Schritten, mir macht einfach meine Arbeit Freude, aber ich könnte mir schon vorstellen, jetzt auch wieder einen größeren Film zu machen. Mal sehen, ob sich ein entsprechendes Projekt finden lässt.
Das Gespräch führte Thomas Schultze.