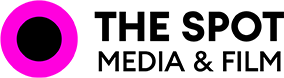Morgen startet mit „Hagen – Im Tal der Nibelungen“ eine der größten deutschen Produktionen aller Zeiten im Verleih von Constantin Film in den Kinos. Im Umfeld der gestrigen Deutschlandpremiere in München haben wir uns mit den Filmemachern Cyrill Boss und Philipp Stennert über ihren Ausnahmefilm unterhalten.

„Hagen – Im Tal der Nibelungen“ ist die mit Abstand aufwändigste Arbeit, die Sie jemals gemacht haben. Haben Sie die schlaflosen Nächte, die ein solches Projekt zwangsläufig mit sich bringt, auf dem Weg mitgezählt?
Cyrill Boss: Es war ein anstrengendes Projekt. Allein aufgrund der langen Produktionszeit. Wir waren 2020 mitten in der Produktion der zweiten Staffel von „Der Pass“, die wegen Corona unterbrochen werden musste. Da haben wir mit dem Drehbuch für „Hagen – Im Tal der Nibelungen“ begonnen. Dann haben wir „Der Pass“ zu Ende gedreht und gingen im Anschluss direkt in die weitere Schreib-, Produktions- und Drehphase. Bis jetzt haben wir ohne Pause an dem Projekt gearbeitet. Tatsächlich sind wir mit der sechsteiligen Miniserie, die nächstes Jahr herauskommen wird, noch nicht ganz fertig, liegen aber in den letzten Zügen mit Finalisierung der Musik und der Mischung. Es sind also vier Jahre durchgehender Arbeit, und da gibt es natürlich auch immer wieder Phasen, in denen man weniger gut schläft, einfach aufgrund des schieren Ausmaßes des Projekts, bei dem man viele Dinge parallel machen musste, weil wir zugleich einen Spielfilm und eine Miniserie in einem gedreht haben. Diesen Aufwand hätten wir ohne unser großartiges Team niemals meistern können.
Philipp Steinert: Vor dem Dreh hatte ich einen Moment, in dem mir einer der Gründe so richtig bewusst wurde, warum es unabsehbar ist, ob dieses Projekt überhaupt funktionieren wird: die Vielzahl von sehr unterschiedlichen Genre-Elementen. Man hat es mit Fantasy, teilweise Horror-Elementen und Action zu tun, über allem liegt das große Familiendrama, dazu noch die Liebesgeschichten… Ich weiß noch, das war ein kurzer Krisenmoment bei mir: Wie sollen wir das alles unter einen Hut bekommen, wie können wir daraus einen Film aus einem Guss machen? Rückblickend war das ein guter Moment. Zweifel sind ein guter Ansporn, das Beste aus sich herauszuholen. Natürlich war das nicht einfach, die größte Herausforderung, der wir uns bisher gestellt haben, sowohl was das Drehbuch wie auch die Produktion anbetrifft: Die disparaten Teile mussten sich zu einem homogenen Stoff fügen.
Sahen Sie sich mit dem Problem konfrontiert, das alle deutschen Filmemacher zwangsläufig haben müssen, die sich an ein Projekt wagen, das über den gängigen Budgetrahmen deutscher Produktionen hinausgeht? Es ist auch ein klarer Schritt heraus aus der Komfortzone: Man wird automatisch an vergleichbaren Stoffen aus Hollywood gemessen.
Cyrill Boss: Von solchen Gedanken muss man sich freimachen. Das darf auch niemals die Maßgabe sein, egal wie groß ein Projekt ist. Es kommt immer darauf an, dem eigenen Stoff gerecht zu werden. Zunächst einmal haben wir es als große Ehre empfunden, das Privileg zu erhalten, diese größte aller deutschen Sagen verfilmen zu dürfen, eine tolle Chance, die Nibelungensage in einem neuen Gewand auf die Leinwand zu bringen, und zwar IN dieser Zeit erzählt, aber FÜR unsere Zeit neu interpretieren, mit all den Dingen, die in den Jahrhunderten seither passiert sind, die man in diese Urgeschichte mit einbringen kann. Weil wir uns erst einmal klarwerden mussten, was genau wir erzählen wollten, was unser Kernthema sein sollte, war diese Maßgabe unsere Hauptantriebsfeder. Wir haben nicht in Richtung „Game of Thrones“ oder „Der Herr der Ringe“ geschielt und Vergleiche angestellt, sondern haben uns hundertprozentig auf unseren Stoff konzentriert und unser Ziel, ein starkes Familiendrama mit extrem interessanten Frauenfiguren und einem ganz starken Kernthema umzusetzen, das Wolfgang Hohlbein in seiner Romanvorlage brillant freigelegt hat: der Gegensatz der beiden Hauptfiguren, Hagen und Siegfried. Dass wir uns damit auf ein Terrain bewegen würden, in dem Vergleiche gezogen werden, ist uns erst später richtig bewusst geworden.

Philipp Stennert: Ich verstehe, warum die genannten Titel als Referenzen oder Vergleiche herangezogen werden. Aber als es bei uns an die Vorbereitung ging, an die Überlegungen für das Setdesign, die Kostüme, die VFXen und so weiter, da spielten solche Vergleiche keine Rolle. Und wir waren sehr darauf fokussiert in allen filmischen Ebenen unserer eigenen Geschichte gerecht zu werden, ihr zu entsprechen, sie bestmöglich umzusetzen. Unsere Quellen der Inspiration kamen dramaturgisch wie visuell dabei aus ganz anderen Richtungen.
Dabei haben sie aber nicht die Sage verfilmt, nicht das Nibelungenlied, sondern den Roman von Wolfgang Hohlbein, der wie ein Zerrspiegel auf das Nibelungenlied blickt und ihm einen völlig eigenen, tragischen Dreh gibt.
Cyrill Boss: Man muss grundsätzlich erst einmal unterscheiden zwischen Nibelungensage und Nibelungenlied, die man gerne mal miteinander vermischt, was aber nicht korrekt ist. Die Sage an sich ist in vielen unterschiedlichsten Varianten erzählt worden, eine davon ist das Nibelungenlied, das auch nur einen Auszug aus der Sage darstellt. Entsprechend hat sie sich im Lauf der Jahrhunderte gewandelt, kamen neue Einflüsse und Elemente dazu, mit denen sich die Figuren, ihre Beziehungen, aber auch die Rollen von Frau und Mann veränderten. Immer wenn die Sage neu erzählt wurde, wurde sie anders erzählt. Um all das besser zu verstehen und selbst keine historischen Fehler zu machen, haben wir auch einen Historiker zu Rat gezogen, der uns beruhigen konnte: Es ist eben keine faktisch belegte Geschichte, sondern eine Sage, die per definitionem davon lebt, immer wieder verändert zu werden und sich aus neuen Einflüssen zu speisen.
Philipp Stennert: Was Wolfgang Hohlbein toll gemacht und was uns sehr geholfen hat, war der klare Fokus, den er legt. Er hat sich auf den Teil der Sage konzentriert zwischen der Ankunft Siegfrieds in Worms und seinem Tod. Dieser Ansatz hat uns ein starkes Plot-Gerüst für das Drehbuch gegeben. Was wir in dem Roman zudem gefunden haben, gerade weil Hohlbein sich die gewagte künstlerische Freiheit nimmt, die Charaktere der beiden Hauptfiguren neu zu definieren und eine andere Perspektive auf sie zu haben, ist der großartige Kontrast zwischen Hagen und Siegfried, diese beiden Männer, die auch archetypisch für zwei Kräfte stehen, deren Konflikt wir alle kennen. Da hatten wir sofort einen Zugang, weil es zeitlos ist und zutiefst menschlich. Daraus ließ sich ein starkes Kinodrehbuch machen.
Man muss dann aber erst einmal machen. Was haben Sie bei der Produktion selbst als größte Herausforderungen empfunden?
Philipp Stennert: Es gab auf vielen Ebenen viele Herausforderungen – alle aufzulisten, würde den Rahmen eines Interviews vermutlich sprengen. Aber wenn ich einen Punkt herausgreifen darf: Als besondere Herausforderung habe ich empfunden, innerhalb des gegebenen Rahmens – und ich will betonen, dass uns ein umfassendes Budget zur Verfügung stand – tatsächlich das Projekt umsetzen zu können, das uns vorschwebte. Wenn man sich ansieht, welche Genres wir bedienen, und dass wir in unseren 113 Drehtagen parallel zum Film auch noch eine sechsteilige Serie umgesetzt haben, ist es doch nicht so, dass wir prassen konnten. Im Gegenteil. Wir sind sehr effizient vorgegangen, haben lange immer wieder überlegt, wie man jeden Euro bestmöglich ausgibt und sichtbar macht. Das war ein Dauerthema. Wenn es an die Umsetzung der Schlachten geht, muss man sich klarmachen, was man wirklich damit erzählen will. Ist es einfach nur ein Schauwert? Zeigen wir kämpfende Ritter nur, weil wir jetzt Lust darauf haben und es wieder Zeit für etwas Action ist – oder kann man die Geschichte damit weiterbringen? Die Drehtage für aufwändige Actionszenen waren sehr begrenzt. Also musste jede Einstellung genau geplant und vorbereitet werden, damit man kein Geld und keine Zeit verschwendet.

Cyrill Boss: Speziell bei diesem Projekt war es wichtig ausreichend Zeit für eine gründliche Vorbereitung zu haben. So konnten wir gewährleisten, dass die einzelnen Gewerke jeweils ein Maximum leisten konnten. Teilweise konnten wir mit Kreativen arbeiten, die wir bereits kannten, teilweise waren es aber auch für uns neue Leute, und da braucht es immer ein bisschen, bis man eine gemeinsame Sprache findet. Matthias Müsse, der mit unserer Vision brillant umgehen kann und dann ein riesiges Team in Prag führen kann, mit dem er all die großartigen Sets hat entstehen lassen. Pierre-Yves Gayraud, der zuvor bei „Das Parfum“ und „Babylon Berlin“ gearbeitet hatte, den wir noch nicht kannten, der sich nach ersten Gesprächen mit großer Leidenschaft in den Entwurf der Kostüme geworfen hat. In fast allen Fällen war es so, dass wir nur den Anstoß geben mussten, den zündenden Funke, dann übernahmen alle Verantwortung und es entstand ein echtes Feuer in den Abteilungen.
Sie haben bereits angesprochen: Es gibt „Hagen“, den Kinofilm, und es gibt „Hagen“, die Miniserie“. Worin unterscheiden Sie sich?
Cyrill Boss: Es gab für beides Drehbücher, sechs Drehbücher für die Miniserie, ein Drehbuch für den Film. Beides lag vor, als wir in den Dreh gingen. Wir haben das dann aber bei der Umsetzung tatsächlich so behandelt wie ein großes Werk, wobei wir den Kinofilm als Hauptstrang immer im Blick hatten. Der Kinofilm erzählt die Geschichte von Hagen von Tronje und die Rivalität zu Siegfried von Xanten als treibende dramatische Kraft. Es ist seine Perspektive. Wie erlebt er die Geschichte? Die Serie nimmt sich mehr Zeit für die verschiedenen Mitglieder der Familie, sie ist mehr eine Ensemblegeschichte. Das haben wir im Dreh entsprechend durchgezogen, in der Hoffnung, dass sich das auch im Schnitt so umsetzen lässt. In dieser intensiven Phase haben wir dann aber auch gemerkt, dass man nicht immer im Sinne des Filmes handelt, wenn man allzu sklavisch an der Perspektive von Hagen festhält. Man kann zum Beispiel die Geschichte von Siegfried und Kriemhild nicht komplett ausklammern. Der Zuschauer muss diese Beziehung verstehen und nachvollziehen können. Also sind wir an bestimmten Stellen von unserem rigiden Korsett abgewichen. Ich denke, auf diese Weise ist in der Überarbeitung ein besserer, emotionalerer Film entstanden.
Ab einer gewissen Größe eines Filmprojekts gibt es zwangsläufig immer mehr Leute, die genau wissen, was richtig ist für einen Film, was die Regisseure umso stärker um ihre Vision kämpfen und ringen lässt. War das in Ihrem Fall auch so?
Philipp Stennert: Das war es schon. Wobei es niemals so war, dass jemand gegen uns gearbeitet hätte. Wir haben immer gemeinschaftlich gearbeitet, an einem Strang gezogen, um den bestmöglichen Film zu machen. Aber natürlich stimmt es, dass man ab einer gewissen Größe mehr Meinungen zu hören bekommt, als wenn man einen kleineren Film umsetzt. Das kann einen auch verunsichern. Wichtig ist es, dass man sich immer wieder darauf fokussiert, was man ursprünglich machen, was man erzählen wollte. Das muss man einerseits hinterfragen, andererseits auch dafür einstehen. Da war es schon hilfreich, dass wir zu zweit arbeiten und viele Dinge auch zwischen uns immer wieder durchdiskutieren konnten. Das bestärkt einen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auszusortieren, welche äußeren Einflüsse hilfreich und welche nur ein Rauschen sind, die einen ablenkt von dem, was zu machen ist.

Vor „Hagen“ haben Sie zwei Staffeln „Der Pass“ gemacht, damals auch Neuland für Sie und Ausdruck einer größeren Ambition als Filmemacher. Hat das für die Arbeit an Ihrem Mammutwerk geholfen?
Cyrill Boss: „Der Pass“ war sehr speziell, weil er so nah an unserem Kulturkreis und unserem Leben war. Ich komme aus München, habe als Junge viel Zeit nahe der Berge verbracht, bin mit dem Krampus aufgewachsen. Philipp hat einen starken Bezug zu Österreich, weil seine Familie am Attersee ein Haus hat, wo man sich trifft. Da kamen viele Dinge direkt aus uns heraus, haben wir aus unserer Prägung heraus entwickelt, was anders war als die meisten anderen Projekte, an denen wir gearbeitet haben, für die es meist bereits Vorbilder gab. „Das Haus der Krokodile“ basierte auf einem Roman, „Hagen“ basiert ebenfalls auf einem Roman und einer Sage. Wenn es eine Erfahrung gab, von der wir für „Hagen“ profitieren konnten, dann war es, dass wir auch bei „Der Pass“ nie aufgehört haben zu hinterfragen, was wir eigentlich erzählen wollen, ob wir noch auf dem richtigen Pfad sind, ob man etwas nicht besser anders machen sollte oder einfach blind auf bewährte Genre-Muster vertrauen sollte. „Der Pass“ hatte im Kern ein unglaublich starkes Thema, an das wir geglaubt haben und von dem wir uns leiten ließen.
Die vierjährige Reise von „Hagen“ geht langsam für Sie zu Ende. Am vergangenen Freitag gab es die gefeierte Weltpremiere des Films in Zürich. Was stellt das emotional mit einem an?
Philipp Stennert: Worauf man sich als Filmemacher, neben all der Nervosität, die man hat, wenn man jahrelang hinter verschlossenen Türen in seinem Kämmerlein an einem Film gearbeitet hat, wirklich freut, ist die Tatsache, dass man jetzt endlich mit anderen Menschen darüber sprechen kann, ganz normale Menschen, die nicht mitgearbeitet haben am Film. Man will eine Geschichte erzählen, die Leute zu Gesprächen anregt, zu Gedanken. Man will Diskussionen auslösen und gerne auch Kritik. Das ist das wahre Geschenk. Deshalb tun wir das. Wir wollen Ideen kommunizieren, in unserem Fall geschieht das über Geschichten, die man auf der Leinwand oder vor einem Bildschirm erlebt. Das soll jetzt endlich beginnen!
Das Gespräch führte Thomas Schultze.