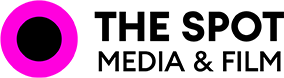Hartes Sozialdrama über und aus der Sicht einer Neunjährigen, die ihre Familie aus der Abwärtsspirale aus Armut und Verwahrlosung befreien will.

FAST FACTS:
• Berührendes, sozialkritisches Drama der österreichischen Editorin, Regisseurin und Drehbuchautorin Ulrike Kofler („Was wir wollten“, „Sexuell verfügbar“, „Corsage“)
• Weibliches Drei-Generationen-Porträt über den Versuch einer Neunjährigen, ihre Familie aus der Armutsspirale zu befreien
• Weltpremiere beim Filmfest München in der Reihe CineVision
CREDITS:
O-Titel: Gina; Land/Jahr: Österreich, 2024; Laufzeit: 100 Minuten; Drehbuch: Ulrike Kofler; Regie: Ulrike Kofler; Cast: Emma Lotta Simmer, Marie-Luise Stockinger, Lion Tatzber, Nino Tatzber, Gerti Drassl, Michael Steinocher, Ursula Strauss
REVIEW:
Es liegt an den Händen: Gina hat die gleichen Hände wie ihre Mutter und ihre Großmutter, behauptet diese jedenfalls, und damit auch die gleiche Schicksalslinie. Die Neunjährige versteht in diesem Moment zwar noch nicht, was Schicksal ist, aber sie weiß, dass sie mit ihren Händen fantastische Schattenfiguren machen kann. Und dass die Hände ihrer Mutter Gitte meistens Zigaretten oder Bierdosen halten und sie oft wegstoßen, wenn Gina Hilfe braucht, eben jemanden, der sie an die Hand nimmt. Gitte ist alleinerziehend, arbeitslos, alkoholkrank, noch dazu hochschwanger mit ihrem vierten Kind, und sie verlässt sich darauf, dass sich ihre Tochter um alles kümmert, um sie und die zwei jüngeren Brüder. Gina tut ihr Bestes, um auf alle aufzupassen, sie mogelt sich ohne Eintrittskarte ins Schwimmbad, wo sie am Beckenrand sitzt, weil sie nicht schwimmen kann, Chipstüten oder Colaflaschen klaut, und später für alle das Abendbrot macht, aber wenn die Sozialhilfe zu spät kommt und die Oma nicht aushilft, bleibt der Kühlschrank leer. Eigentlich sind sie die ganze Zeithungrig. Es wird besser, sobald das Baby da ist, glaubt Gina, und wenn dessen Vater Vincent, der ein teures Auto fährt und ab und zu Pizza mitbringt, bei ihnen bleibt. Vincent hat allerdings bereits eine Familie mit einer anderen Frau, und als Gitte davon erfährt, verliert auch sie die letzte Hoffnung, dass sich an ihrer Situation jemals etwas ändern wird. Es eskaliert sowieso, scheint sie sich zu sagen, „so ist das nun mal bei uns“, sagt die Oma. Doch damit will sich Gina nicht abfinden.
Mit ihrem zweiten Spielfilm als Regisseurin und Drehbuchautorin nach dem Beziehungsdrama „Was wir wollten“, das 2020 als österreichischer Kandidat für den Oscar für den besten internationalen Film vorgeschlagen wurde, widmet sich Ulrike Kofler erneut dem Thema Mutterschaft, diesmal aus der Perspektive eines – vernachlässigten – Kindes. Die Kamera folgt dem Blick der neunjährigen Titelfigur, ist immer auf ihrer Augenhöhe, zeigt das, was für sie greifbar ist, Details statt großer Zusammenhänge, und bleibt in skeptischer Distanz zu den Erwachsenen. Es gibt kaum Nähe oder Zärtlichkeit in dem heruntergekommenen Haus, in dem der Putz von den Wänden bröckelt, und das mit seinem zertrampelten Garten fast wie eine umkämpfte Bastion gegen Eindringlinge wirkt, etwa den Vermieter oder die Jugendfürsorgerin, die offenbar nur darauf warten, dass irgendetwas passiert, damit sie handeln können. Als gäbe es nicht schon genügend Gründe dafür: Gitte trinkt, raucht Kette, streitet lautstark mit Vincent, alles vor der Nase ihrer Kinder, und verlangt von Gina mitten in der Nacht, dass sie sich zu ihrer betrunkenen Mutter ins Auto setzt, um mit ihr „einen kleinen Wein“ von der Tankstelle zu holen. Die drei Kinder tragen abwechselnd die gleichen Sachen, Gina einen viel zu großen Badeanzug, sie stolpert beim Schulausflug in Sandalen statt in Wanderschuhen durch den Wald, hortet heimlich Essensreste vom Vortag, um am nächsten Abend nicht mit knurrendem Magen ins Bett zu gehen, das nur aus einer Matratze besteht, und auf der ab und zu eine Scheibe Brot liegt.
Es ist manchmal hart an der Grenze zu Poverty-Porn, wenn der Hintergrund zu sehr in den Vordergrund rückt, in dem eigentlich die Charaktere und die großartigen Darstellerinnen stehen, die alles nachvollziehbar machen, selbst wenn man Gitte und Branca ständig an den Schultern packen und durchschütteln möchte, weil man es gar nicht glauben kann, wie ungeheuerlich ihr Verhalten ist. Ulrike Kofler will ihre Protagonistinnen nicht verurteilen, sondern aufzeigen, wie sich die schicksalshafte Abwärtsspirale aus fehlender familiärer Stabilität und Bildung, Armut, Verwahrlosung, Lieblosigkeit von Generation zu Generation traumatisch wiederholt und deshalb umso schwerer aus eigener Kraft zu durchbrechen ist. Während die überheblich arrogante Branca, gespielt von Gerti Drassl, eine Strategie gefunden hat, die es ihr erlaubt, ihr Leben zu leben und Schuldzuweisungen und Vorwürfe ihrer Tochter an sich abprallen zu lassen, reagiert diese auf alles mit schnoddriger, ungezogener Sturheit. Die gleiche trotzige Haltung hat sich Gina angeeignet, wie überhaupt alles, was Gitte tut, so wie es Kinder nun einmal machen. Sie tischt dem Jugendamt, ohne mit der Wimper zu zucken, Lügen auf oder redet es schön, dass es immer nur Zwetschgenknödel gibt, wenn sich ihre Mutter tatsächlich einmal um die Grundversorgung der Familie kümmert.
Die beklemmende Anspannung des Dramas entwickelt sich vor allem aus den Blicken und der Dynamik von Gitte und Gina, aus ihrer umgekehrten und verkehrten Mutter-Kind-Beziehung. Während sich Gitte, schockierend authentisch verkörpert von der Burgtheater-Schauspielerin Marie-Luise Stockinger, immer mehr auf den Abgrund zubewegt, stößt sie Gina immer weiter von sich weg und überträgt ihre Enttäuschung und Wut auf ihre Tochter. Emma Lotta Simmer spielt ihre Rolle mit einer erstaunlichen Intensität und traurigen Trostlosigkeit, die andauernde Zurückweisung bringt sie schließlich dazu, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, mit ebenso brutaler Härte, wie sie sie von Gitte gelernt hat – und mit gewaltsamer Hilfe von außen, ohne die es eben nicht geht. Trotz aller ernüchternden Konsequenz hat Ulrike Koflers Film einen sehnsuchtsvollen Freiheitsgedanken, den er der Perspektive der neunjährigen Hauptfigur verdankt, den Szenen, in denen die Kamera mit ihr in den Himmel schaukelt, ihre Schattenspiele an der Wand verfolgt oder den Garten zum Spielplatz macht. Und ganz am Schluss, wenn die melancholische Musik der österreichischen Band Wallners auf den Song „All Again“ hinausläuft, der von dem Wunsch handelt, mit Vergangenem abzuschließen und neu zu beginnen, zeigt sie dann allen anderen auch, dass es nie zu spät ist, um Schwimmen zu lernen.
Corinna Götz