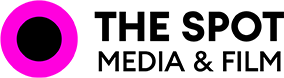Aktuell rockt „Die leisen und die großen Töne“ die französischen Kinos, nachdem der Film mit Benjamin Lavernhe und Pierre Lottin seit Cannes zahlreiche Festivals in Verzückung versetzte. Kurz vor dem Kinostart im Verleih von Neue Visionen am 26. Dezember haben wir mit Regisseur und Autor Emmanuel Courcol gesprochen.

Während die Welt hadert und die Menschen ins Kino zurückholen will, gelingt es dem französischen Film vermeintlich spielend. Was muss ein Film Ihrer Ansicht nach haben, um ein Kinofilm zu sein? Was lieben Sie am Kino?
Emmanuel Courcol: Wenn ich sehe, welche Reaktionen ich bei diesem Film vom Publikum bekomme, wie das Publikum auf den Film reagiert, dann weiß ich, warum ich Kino mache. Ich habe überhaupt relativ spät begonnen, als Regisseur zu arbeiten. Zuerst war ich Schauspieler, dann habe ich angefangen, Drehbücher zu schreiben. Erst dann bin ich zur Regie gekommen. Für mich ist Kino und Filmemachen nicht einfach so eine kleine persönliche Geschichte. Ich möchte das teilen. Ich möchte es mit einem Publikum teilen. Natürlich ist das Filmemachen auch anstrengend. Aber es bereitet mir Freude. Im Kino gibt es viele deprimierende, traurige, schwere Filme. Es gibt viele Filmemacher, die diese Art von Kino machen. Viele von ihnen machen das auch ausgezeichnet. Aber wenn ich einen Film mache, dann will ich mehr machen.
Die ganz leichte Kost ist „Die leisen und die großen Töne“ aber auch nicht.
Emmanuel Courcol: Das nicht, soll es auch nicht sein. Ich meine das auch anders. Ich nehme mir auch schwere Themen vor, aber sie sollen dem Publikum guttun. Ich will wenigstens sagen: Ich verstehe, die aktuelle Lage ist nicht einfach, vieles sieht nicht gut aus. Aber es ist nicht alles verloren. Das will ich mit meinem Kino ausdrücken. Das sind die Geschichten, die ich in meinem Kino vermitteln will.
Ich gebe Ihnen recht. Sie machen dem Publikum nichts vor, blenden die Realität nicht aus, aber sie spenden Trost, nehmen den Zuschauer:in in den Arm. Wie halten Sie diese Balance?
Emmanuel Courcol: Ich wollte kein Märchen drehen. Der Film sollte in einer nachvollziehbaren sozialen und wirtschaftlichen Realität verhaftet sein. Was ich da zeige, das musste auch stimmen. Zur sozialen Realität in dieser Gegend gehört es leider auch, dass es Fabrikschließungen gibt. Es war mir wichtig, das zu zeigen. Gerade auch wenn es um die Brüder ging, spielte Authentizität eine wichtige Rolle. Sie mussten authentisch sein. Die beiden Orchester mussten authentisch sein, sowohl die Marschkapelle wie auch das professionelle Sinfonie-Orchester. Wenn ich die Geschichte schon im Norden des Landes ansiedle, dann musste es stimmig sein. Ich wollte einen ehrlichen Film machen.
Haben Sie auch vor Ort recherchiert?
Emmanuel Courcol: Ich habe mir viele Betriebe angesehen, um den idealen Drehort zu finden. Das ist schon auch sehr deprimierend, weil es eine Region ist, die eine starke Industrievergangenheit vorzuweisen hat, und die nun eben auseinanderfällt. Das kann man nicht wegleugnen. Aber es ist auch nicht die Geschichte, die ich primär erzählen wollte. Sie nimmt keinen großen Raum ein in meinem Film, aber sie spielt auch eine wichtige Rolle für alles andere, was passiert. Deshalb wollte ich nicht wegschauen. Es musste stimmen. Es ist, als würde man eine Tür öffnen und eine neue Realität zeigen. Dann schließt man die Tür wieder, aber was man gesehen hat, wirkt nach. Es ist auch wichtig für die Entwicklung von Thibaut, gespielt von Benjamin Lavernhe, der wirklich aus einer anderen sozialen Realität kommt. Er lebt in seiner eigenen Blase, lebt in einer Welt der Hotels und Flugreisen, von einem Ort zu einem anderen. Er weiß natürlich, dass es diese andere Welt gibt. Aber er hat kein Verhältnis zu ihr. Jetzt lernt er sie kennen durch seinen Bruder. Er kann nicht wissen, was es für Arbeiter bedeutet, in der Angst leben zu müssen, dass ihre Fabrik schließt. Das jetzt wirklich mitzuerleben, stellt natürlich etwas mit ihm an.

Sie erzählen die Geschichte einer Annäherung. Er muss lernen, dass sein Blick auf die Welt seines Bruders geprägt ist von Klischees. So lange er das nicht realisiert, bleibt er zwangsläufig gönnerhaft, nicht auf Augenhöhe. Genau darum geht es in Ihrem Film, das Begegnen auf Augenhöhe, etwas, das einen Nerv trifft in einer Zeit, in der Menschen sich außer Stande sehen, mit ihrer Umwelt in Dialog zu treten. War Ihnen die Botschaft wichtig?
Emmanuel Courcol: Es ist eine Frage des Respekts, dass der andere genauso viel Wert ist wie man selbst. Und da kommt die Macht der Musik ins Spiel. Wir haben sehr darauf geachtet, dass es keine Hierarchien gibt in der Musik, ob es klassische Musik ist, Jazz oder Populärmusik. Thibaut merkt schnell, als er die Musiker der Marschkapelle trifft, dass sie andere Werte verkörpern. Das geht es nicht um Perfektion oder Virtuosität als Musiker. Es geht um andere Dinge. Es dauert eine Weile, aber schließlich erkennt Thibaut, dass sein Bruder sein Alter ego ist, eine buchstäblich verwandte Seele. Zu Beginn des Films war das noch nicht so. Da war Jimmy jemand, den er braucht, um zu überleben und seine Krankheit zu meistern. Zu diesem Zeitpunkt ist er noch sehr in seinem Klassendünkel gefangen. Es sind keine großen Emotionen im Spiel. Bei Jimmy ist es nicht anders. Thibaut ist zunächst ein Eindringling, ein Störenfried, ein bourgeoiser Typ, mit dem er nichts anfangen kann. Es ist dann die Musik, die sie Gemeinsamkeiten entdecken lässt. So kann eine Kommunikation überhaupt erst stattfinden.

Stichwort Musik: Die Art und Weise, wie die Musik präsentiert wird, wie die Musik gezeigt wird, wie über Musik gesprochen wird, wie die Brüder ihre Liebe für die Musik teilen, sagt zumindest mir, dass dieser Film von jemand geschrieben sein muss, der selbst die Musik liebt. Ist es ein persönlicher Film?
Emmanuel Courcol: Musik war mir immer sehr wichtig. Ich habe in meiner Jugend viel Klassik gehört. Meine Eltern hatten einen Plattenkoffer mit 15 oder 20 Alben drin, und das war vornehmlich klassische Musik. Wenn ich in meinem Zimmer war, habe ich mir vorgestellt, ein Dirigent zu sein. Später habe ich auch den Jazz entdeckt und lieben gelernt. Ich bin kein Spezialist, die Musik bedeutet mir aber viel. Mit der Zeit habe ich einen sehr eklektischen Geschmack entwickelt. Natürlich liegt er vielen Aspekten der Geschichte, die ich in „Die leisen und die großen Töne“ erzähle, zugrunde.
„Die leisen und die großen Töne“ ist nicht unbedingt die Art von Film, die für Cannes ausgewählt wird. Dennoch haben Sie dort Weltpremiere gefeiert. Was hat Ihnen das bedeutet? Was hat es dem Film gebracht?
Emmanuel Courcol: Cannes ist ein Mythos. Schon mein vorhergehender Film, „Ein Triumph“, war in die Sélection officielle gewählt worden, dann fiel der Jahrgang der Covid-Pandemie zum Opfer. Jetzt war ich also zum ersten Mal wirklich dabei. Für mich kam das sehr unerwartet, weil ich, wie schon gesagt, eben sehr spät angefangen habe, als Regisseur zu arbeiten. Es war also echt ein Wahnsinn. Dann ist ja auch die echte Marschkapelle aufgetreten und hat „Emmenez-moi“ von Charles Aznavour gespielt. Das war großartig. Es war ein wunderbarer Moment für mich als junger Filmemacher.
Das Gespräch führte Thomas Schultze.