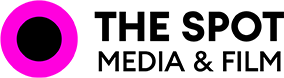Brillantes, furioses, menschliches und beklemmend authentisches Coming-of-Age-Drama vor dem Hintergrund der Luftangriffe auf London während des Zweiten Weltkriegs
FAST FACTS:
• Fünfter Spielfilm des britischen Turner-, BAFTA-, Oscar-Preisträgers Sir Steve McQueen nach „Hunger“, „Shame“, „12 Years a Slave“ und „Widows“
• Oscar-verdächtige Hauptdarsteller: Saoirse Ronan und Newcomer Elliott Heffernan
• Weltpremiere beim BFI London Filmfestivals, zeitgleich beim Zurich Film Festival, US-Premiere beim New York Film Festival
CREDITS:
O-Titel: Blitz; Land/Jahr: UK/USA 2024; Laufzeit: 120 Minuten; Drehbuch: Steve McQueen; Regie: Steve McQueen; Besetzung: Saoirse Ronan, Elliott Heffernan, Paul Weller, Harris Dickinson, Benjamin Clémentine, Kathy Burke, Stephen Graham, CJ Beckford; Verleih: Apple; Start: ab 7. November 2024 in ausgewählten Kinos, ab 22. November 2024 auf Apple TV+
REVIEW:
Das Kino interessiere ihn, weil es jeden anspricht, wie Musik, sagte Steve McQueen einmal in einem Interview, und sein bisher schönster, vielleicht bester Film bringt beides in einen perfekten Gleichklang: In „Lovers Rock“, dem zweiten Teil seines „Small Axe“-Zyklus über das Leben karibischer Einwanderer in London, der 2020 für die BBC entstand, verlässt sich McQueen ganz auf die Musik, um eine Verbindung zwischen den Charakteren und zum Publikum herzustellen. Es ist eine Lovestory, die sich auf der Tanzfläche bei einer Reggae-Hausparty anbahnt, die den Zuschauer in ein Wohnzimmer in Notting Hill im Jahr 1980 holt, immersives Kino ohne Sentimentalitäten, eine Hymne an die Liebe und die Menschlichkeit. Das alles spürt man auch in seinem neuen Film, mit dem McQueen einmal mehr die Gangart wechselt, um die Black British Experience in einem neuen historischen und erzählerischen Kontext zu platzieren, dort, wo ihn die Wahrheitssuche als Künstler eben gerade hinführt. Sein Ausgangspunkt war in diesem Fall das Foto eines schwarzen Jungen auf einem Bahnhof, aufgenommen während des Zweiten Weltkriegs, auf das er bei Recherchen zu „Small Axe“ gestoßen war. Somit beantwortet „Blitz“ unter anderem die Frage, wie sich Krieg aus der Sicht eines Kindes anfühlt, wie sich „The Blitz“, die verheerende Serie von Luftangriffen auf London im Herbst 1940, für das schwarze Kind auf dem Foto angefühlt haben mag.

Der Film, dessen Drehbuch McQueen erstmals ohne Ko-Autor verfasst hat, ist damit in weiten Teilen eine fiktive, identitätsstiftende Coming-of-Age-Odyssee. Noch mehr beschäftigen den Filmemacher jedoch auch hier die wahren Ereignisse, der institutionalisierte Rassismus in seiner Heimat, wie er ihn zuvor nicht nur in „Small Axe“ aufgezeigt hat, sondern auch in der dreiteiligen Fernsehdokumentation „Uprising“ über das „New Cross Fire“, bei dem 1981 dreizehn junge Schwarze ums Leben kamen und das eine bis heute anhaltende Serie von Protesten in Gang setzte. Weitere Anknüpfungspunkte lieferte sein monumentaler Dokumentarfilm „Occupied City“, in dem McQueen jeden Ort in Amsterdam aufsuchte, an dem die Spuren der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung durch die Nationalsozialisten weiterhin sichtbar sind. Auf ähnliche Weise durchmisst er nun die britische Hauptstadt, markiert die Stellen auf deren innerer Landkarte, an denen es besonders weh tut, legt den Finger in die Wunden, die der London Blitz hinterlassen hat, porträtiert die Menschen, die in anderen Filmen über den Zweiten Weltkrieg unter dem Radar verschwinden. Er durchlöchert den Mythos der „Keep Calm and Carry On“-Mentalität, die von der Regierung propagandiert wurde, um das öffentliche Leben am Laufen zu halten, erzählt die Geschichten der Arbeiterklasse, von alleinstehenden Müttern, Feuerwehrmännern, People of Colour auf einem beklemmend authentischen Streifzug durch eine Stadt im Ausnahmezustand.
So beginnt „Blitz“ dann auch mittendrin, in einer höllischen Feuersbrunst, in der die Kamera hektisch zwischen Löschfahrzeugen und Männern hin und her schwenkt, die versuchen, einen unter Druck stehenden Wasserschlauch unter Kontrolle zu bringen. Eine Opening Sequence, die gleich zur Sache kommt, Ton und Thema klarmacht, das Publikum vom ersten Moment an am Kragen packt, um es im Folgenden immer wieder unerbittlich den Bildern einer gesichtslosen Bedrohung auszusetzen: Vom Boden aus blickt der Betrachter in den Bombenhagel, der aus schwindelerregender Nähe auf ihn herabzustürzen droht, die unheimlichen Umrisse der Luftwaffe spiegeln sich in den Wellen der Themse wider, jede Einstellung, die ganze, häufig in Apple-Hochglanzlack getauchte Bildgestaltung von Yorick Le Saux, der erstmals für Steve McQueen hinter der Kamera stand, ist ein Gedicht. Das Sounddesign mischt Sirenen und Donnergrollen in Hans Zimmers meisterhaften Score, in jedes Lied, das die Reise der Protagonisten begleitet – angefangen mit dem swingenden „Ain‘t Misbehavin‘“, das Paul Weller auf dem Klavier klimpert, in eben jenem Reihenhaus in Stepney, das später in Flammen aufgehen wird.

Der Godfather of Mod ist einer der Musiker, die McQueen in Nebenrollen besetzt hat, mit Working-Class-Credibility und Teetrinker-Gelassenheit mimt er den Vater von Saoirse Ronans Rita, der Mutter des neunjährigen George (Elliott Heffernan). Seinen aus Grenada stammenden Vater Marcus (CJ Beckford) hat George nie kennengelernt, in einer Rückblende erfährt man, dass dieser vor Jahren von rassistischen Cops verhaftet und angeblich abgeschoben wurde. An ihrem letzten gemeinsamen Morgen liegen Rita und George zusammen auf dem Bett, schütteln sich gegenseitig, weil sie so tun, als spielten sie Schlagzeug, sie machen Trommelwirbel in der Luft, um sie bis in die Finger- und Zehenspitzen zu spüren. Mehr benötigt McQueen nicht, um die Nähe seiner Hauptfiguren zu demonstrieren, es braucht schon einen Blitz, um sie auseinanderzureißen. Da die Einschläge lauter werden, im East End zu wenig Schutzräume bereitstehen, ist Rita gezwungen, George mit dem letzten Evakuierungszug aufs Land zu schicken – „ein Abenteuer für Kinder, Erwachsene sind nicht erlaubt“, muntert sie ihn auf, bevor er sie mit einem trotzigen „Ich hasse dich!“ am Bahnhof stehen lässt, was er bald bereuen wird (nicht ganz so schnell wie Julien am Anfang von Louis Malles „Auf Wiedersehen, Kinder“.)
Das Drehbuch wechselt ab jetzt zwischen zwei Handlungssträngen, verwebt die Abenteuer von Mutter und Sohn in den folgenden drei Tagen und Nächten mit historischen Ereignissen, etwa der verheerenden Überschwemmung einer zum Luftschutzbunker umfunktionierten U-Bahnstation, und mit realen Figuren wie dem jüdischen Aktivisten Michael Davies (Leigh Gill), der den Schutzraum organisiert, für den sich Rita ehrenamtlich engagiert. Tagsüber arbeitet sie mit ihren Freundinnen Tilda (Hayley Squires) und Doris (Erin Kellyman) in einer Munitionsfabrik, in der eine hinreißende Schwesternschaft in jeansblauen Overalls und geknoteten Kopftüchern für die Moral der Truppe kämpft. Als Rita in einer BBC-Radio-Talentshow auftritt, die aus der Fabrikhalle gesendet wird – der Text des Songs, den sie für ihren Sohn singt, stammt aus McQueens Feder –, nutzen die Freundinnen die Gelegenheit und protestieren lautstark gegen die mangelnden Schutzmaßnahmen für die Zivilbevölkerung, werden gefeuert und ziehen anschließend zusammen durch die Pubs, die Strumpfnähte bis zum Po aufgemalt, womit der Film andeutet, dass die sexuelle Befreiung bereits hier begonnen hat.

Als Gegengewicht zu der erdrückenden, allgegenwärtigen Angst und Anspannung gönnt McQueen seinen Protagonisten unbeschwerte Momente von märchenhafter Schönheit. Er lässt George auf dem Dach eines dahinrasenden Zugs mit drei anderen blinden Passagieren erleben, was Freiheit bedeutet, um in der nächsten Sekunde einen der Jungen auf brutale Weise in den Tod zu reißen. Zärtlichkeit und Gewalt wechseln wie Tag und Nacht, Schwarz und Weiß. Weil er von den weißen Kindern in seinem Abteil schikaniert wird, beschließt George auf halber Strecke umzukehren, sich zu seiner Familie durchzuschlagen, die ihn bis dahin gegen feindliche Gesinnungen jeglicher Art beschützt hat, er springt aus dem Zug und verabschiedet sich von seiner Kindheit. Auf dem Weg zurück nach Stepney lernt er Menschen von ihren besten und schlechtesten Seiten kennen, erfährt Kameradschaft und Nächstenliebe, findet eine unerwartete Vaterfigur in dem nigerianischen Luftschutzwart Ife (Singer-Songwriter Benjamin Clémentine), der ihn in der „Empire Arcade“ zwischen Schaufenstern mit Kolonialwaren und Black-Face-Karikaturen aufliest und an die Hand nimmt.
Er wird von einer Bande habgieriger Plünderer, angeführt von einem furchterregenden Stephen Graham und einer nicht weniger fiesen Kathy Burke gekidnappt, muss für sie durch zerbombte Juweliergeschäfte kriechen und wird Zeuge, wie nach einer Explosion im legendären „Café de Paris“ die dort immer noch an Tischen sitzenden Leichen geschändet werden. Dieser wohl verstörendsten Sequenz des Films geht eine der schillerndsten voraus, in der sich die Kamera durch den legendären Nachtclub schlängelt, zwischen Kellnern herumwirbelt, die der in Luxus schwelgenden weißen High Society Austern und Champagner auf dem Silbertablett servieren, während auf der Bühne die Big Band von Ken „Snakehips“ Johnson aufspielt, der seinem Beinamen alle Ehre macht – bis der ganze Saal vom Blitz getroffen erstarrt. In einer anderen Szene, die die Quintessenz all dessen ist, wofür man das Kino von McQueen so sehr liebt, folgt der Regisseur der Romanze von Rita und Marcus in einen Jazzclub im Rotlichtviertel von Soho, es ist die ekstatische Rhythm-and-Blues-Version von „Lovers Rock“, und wenn man einen Wunsch frei hätte, wie es am Ende des Films heißt, wäre es das Musical von McQueen an diesem Ort, mit diesem Cast und dieser Musik.
Music is their sanctuary, es ist die Musik, die alles zusammenhält, die George den Weg weist, die Trost spendet, die Stadt vor dem Stillstand bewahrt. Die episodenhafte Inszenierung fängt den Sound der Zeit ein, wie eine Revue, in der jede Figur ihren Solo-Auftritt hat, jede Brass und Big Band, die „Rosie the Riveter“–Truppe in der Fabrikhalle, die „Whistle While You Work“ zum Takt der Maschinen summt, das Skiffle-Trio und der Chor der Schutzsuchenden in der U-Bahnstation. Die Bombardierungen geben den Rhythmus vor, unterbrechen alle Bemühungen um Alltagsnormalität – und die Erzählchronologie. Man fühlt das Chaos, die Ohnmacht, die Ausweglosigkeit, die wie immer in McQueens Filmen von der Entschlossenheit seiner Charaktere durchkreuzt wird. Mit der für ihre Rollen typischen stoischen Beharrlichkeit wischt sich Saoirse Ronan die Verzweiflung und Mascara-Spuren aus dem verweinten Gesicht, muss heimlich nach Luft schnappen, da ihr die Angst und Sorge um ihren Sohn den Atem raubt – und auch das Interesse an einem romantischen Flirt mit dem Feuerwehrmann Jack, der sie in einer Szene vor einer einstürzenden Ziegelwand rettet, in einer anderen bei der Suche nach George hilft und ihr verstohlene, rußverschmierte Blicke zuwirft, Shootingstar Harris Dickinson wird geradezu sträflich unterfordert. Auch mit einigen anderen Nebenfiguren hätte man gerne mehr Zeit verbracht, weil ihnen McQueen selbst dann emotionale Tiefe verleiht, wenn sie gerade mal eine einzige Zeile im Drehbuch haben. Dafür erhält der erstaunliche Oscar-Anwärter Elliott Heffernan die volle Aufmerksamkeit: Sein stilles Gesicht, die Ernsthaftigkeit und kindliche Sturheit, die mit der Zeit einem panischen Misstrauen weicht, ist wie ein stummer „What the hell?“-Kommentar auf die menschlichen Abgründe, mit denen er buchstäblich an jedem Ort des Films konfrontiert wird.
Das akribische Produktdesign von Adam Stockhausen („12 Years a Slave“) sät in der ganzen Stadt, in jedem Schaufenster, auf jedem Ladenschild Hinweise auf Fremdenfeindlichkeit. Wiederholt lässt McQueen seine (realen) Figuren so unmissverständlich die Stimme gegen Rassismus und für Zusammenhalt erheben, dass es jedes Kind versteht, sogar der Polit-Poet und Reggae-Musiker Linton Kwesi Johnson hat im Hintergrund einen Cameo-Auftritt als Straßenprediger. McQueen lässt weder Zweifel an seiner politischen Agenda noch an der abstrakten Hoffnungsvision, die seinen Film umklammert wie das Thema eines Musikstücks, das Schwarz-Weiß-Motiv einer Blumenwiese, das im Bombenhagel aufblitzt (wie schon im Trailer zu sehen). Vielleicht ist es ein wenig zu viel des Guten, dass ein weißes Pferd plakativ durch die Rauchschwaden der zerbombten Straßen galoppiert, ganz zum Schluss, wenn Kamera und Special Effects Bilder der Zerstörung schaffen, die einen endgültig überwältigen. Vielleicht braucht es gerade deshalb die Kinomagie, die George schließlich zum Helden des „Blitz“-Kriegs macht, als man ihn schon verloren glaubt, weil sich diese Welt auch 2024 ohne Menschlichkeit – und ohne Musik – nicht ertragen ließe. Im Kino geht es darum, „wie man in den Bann gezogen und unterhalten werden kann“, sagt McQueen. Wer etwas anderes möchte, könne ja ein Buch lesen.
Corinna Götz