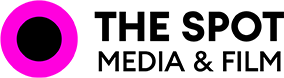Morgen startet endlich Andreas Dresens Berlinale-Hit „In Liebe, Eure Hilde“ im Verleih von Pandora in den deutschen Kinos. Höchste Zeit für ein Gespräch mit dem Regisseur, was ihm der Film bedeutet und wie er die Monate seit der Premiere in Berlin erlebt hat.

Was löst „In Liebe, eure Hilde“ in Ihnen aus, wenn Sie ihn jetzt, mehr als ein halbes Jahr nach der Premiere auf der Berlinale, sehen?
Andreas Dresen: Tatsächlich habe ich den Film seit der Berlinale nicht mehr am Stück gesehen. Weil es mir wirklich schwerfällt. Ich habe ihn logischerweise am Schneidetisch und in der Tonmischung sehr oft erlebt und verinnerlicht. Es ist eine harte Erfahrung, Hilde immer wieder auf ihrem Weg zu begleiten. Mit Publikum entfaltet der Film aber noch einmal eine zusätzliche Wucht. Selbst mir fällt es sehr schwer, mich dem Umstand zu entziehen, dass das, was wir hier zeigen, nicht der Fantasie einer Drehbuchautorin entsprungen ist, sondern eine Realität, die es einmal gegeben hat. Wenn ich Gespräche nach dem Film habe, versuche ich zu vermeiden, schon während der Hinrichtungsszene in den Saal zu kommen. Meist komme ich erst während des Abspanns. Auch der Text des Abschiedsbriefes von Hilde Coppi hat eine unglaubliche Emotionalität. Es sind Worte, die eine Größe haben, die weit über das Geschrieben hinausweisen. Dazu kommt noch die Art und Weise, wie Liv Lisa Fries das spielt, mit dieser Durchlässigkeit. Der Abgrund, der sich unter der Figur auftut, das wühlt mich auf. Es fällt mir schwer, den Film mit Abstand oder neutral zu gucken.
War es denn schon schwer, den Film zu drehen?
Andreas Dresen: Er hat uns alles abverlangt. Wir haben versucht, den Figuren so nahe wie möglich zu kommen, ihr Erleben und Empfinden unmittelbar abzubilden. Da muss man aus der Deckung kommen, sonst geht es nicht. Und natürlich nimmt einen das mit. Es wurde oft geweint, auch hinter der Kamera. Bisweilen fehlten mir die Worte. Wie soll man sich in 13 junge Frauen hineinversetzen, die an einem schönen Sommerabend in einer Schlange auf ihre Hinrichtung warten? Das ist unfassbar und sprengt meine Vorstellungskraft. Was gibt man den jungen Schauspielerinnen mit? Wie inszeniert man dieses Grauen? Ich habe sie dann gebeten, das zu machen, was sie in diesem Moment, in diesem Augenblick, in dieser Situation für richtig empfanden. Jeder Mensch reagiert in solchen Ausnahmesituationen ja anders. Es war sehr bewegend.
„In Liebe, Eure Hilde“ verfügt über eine zunächst kurios erscheinende Rückblendenstruktur. Erst im Verlauf erschließt es sich, dass sie damit chronologisch in die umgekehrte Richtung gehen, von vorne nach hinten. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Andreas Dresen: Als ich die erste Fassung des Drehbuchs gelesen habe, war die Geschichte noch chronologisch erzählt. Der Film zerfiel nach meinem Eindruck dadurch in zwei Hälften. Der erste Teil war die Liebesgeschichte und der Widerstandskampf, der zweite Teil die Geschichte von Hilde und ihrem Baby im Gefängnis. Mich berührte das Drehbuch auf Anhieb. Ich mochte die Figuren, die Szenen, aber die Struktur hatte diese Unwucht. Es ging immer weiter abwärts, war gegen Ende schließlich emotional kaum noch auszuhalten. Ich habe der Drehbuchautorin Laila Stieler dann spontan vorgeschlagen, doch einfach in der Mitte anzufangen, die Geschichte im Gefängnis vorwärts und die Liebesgeschichte rückwärts zu erzählen. Dadurch ist die letzte Szene des Films auch nicht die Hinrichtung, sondern die erste Begegnung zwischen Hilde und Hans, ihr erster Tanz. Laila gefiel die Idee und sie hat sie dann einfach ausprobiert. Wir beide waren sehr angetan von dem Ergebnis.

Es ist in der Tat hilfreich für die Erzählung.
Andreas Dresen: Es bricht nicht nur die monolithischen Strukturen auf, sondern macht gleichzeitig den Schluss optimistischer, ohne die Wucht des Gezeigten zu verraten. Außerdem öffnet sich die beklemmende Gefängniswelt immer wieder für einen Himmel oder einen See, sie wird durchbrochen von der Lebensfeude der jungen Menschen. Meine Hoffnung ist natürlich, dass der Zuschauer dadurch auch offener für die Dinge ist, die als nächstes im dramatischen Teil der Geschichte passieren.
Sie halten damit auch die Aufmerksamkeit des Zuschauers aufrecht über die bloße Erzählung hinaus.
Andreas Dresen: Es entsteht ein kleines Vexierbild für den Zuschauer, der ein bisschen rätseln kann, was es mit der Struktur auf sich hat. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Wir haben versucht, sehr sorgfältig zu sein mit den Fährten, die wir da so legen – und haben dabei immer dem aufmerksamen Zuschauer vertraut, der uns schon folgen wird. Der eine merkt’s ein bisschen früher, der andere ein bisschen später. Aber selbst, wenn man es überhaupt nicht merkt, dass der Film teilweise rückwärts läuft, ist es auch nicht weiter schlimm. Dann sieht man einfach eine Kette von Rückblenden aus der früheren Zeit und hat trotzdem den Eindruck, eine Geschichte erzählt zu bekommen. Wer das Prinzip durchschaut, kann sich natürlich über einen zusätzlichen erzählerischen Reiz freuen.
Sie haben die letzten drei Filme mit Laila Stieler gemacht, die Sie auch betont immer neben Ihren Namen mit auf das Poster der Filme holen. Im Lauf der Jahrzehnte haben Sie bereits ein Dutzend mal miteinander gearbeitet – obwohl man Sie lange Zeit als Regisseur der Texte von Wolfgang Kohlhaase gesehen hat. Sind Sie bei den beiden ein jeweils anderer Filmemacher?
Andreas Dresen: Natürlich sind das ganz unterschiedliche Autoren. Aber ich bin explizit kein anderer Regisseur, wenn ich mit ihren Büchern arbeiten durfte. In der Empathie für die Figuren, in dem liebevollen Blick auf die Welt sind sich Laila und Wolfgang dann doch sehr ähnlich. Und da treffen wir uns alle drei. Wenn man sich für eine Zusammenarbeit entscheidet, dann muss es irgendwie passen in der Sicht auf die Menschen. In dem Moment, wo ich mit Wolfgang arbeiten konnte und jetzt mit Laila arbeiten kann, ist eigentlich schon klar, dass wir nicht diametral die Welt betrachten.
Wir leben in politisch und gesellschaftlich prekären Zeiten. Liegt man denn falsch, wenn man Ihren Film auch als Warnung begreift?
Andreas Dresen: Ich hätte mir gewünscht, dass der Film nicht so aktuell ist. Als wir ihn geplant haben, war es auch nicht so – auch wenn es entsprechende Tendenzen bereits gab. In Deutschland, weltweit, werden rechtspopulistische Kräfte leider gerade wieder sehr stark. Mir war es vor allem wichtig, mit Empathie über Hilde und ihre Freunde zu erzählen, aber jetzt fällt der Film in eine Zeit, in der sich das Nachdenken lohnt, wo man selbst stehen würde, wenn Verhältnisse sich zuspitzen. Wie verhalte ich mich? Man kann in unserem Film ganz gut sehen, dass die Leute, die auf Seiten der Diktatur stehen, sei es der Pfarrer, sei es Anneliese Kühn, sei es der Vernehmer, der dann doch noch ein Leberwurstbrot rüberschiebt, auch Menschen sind. Wir wollten vermeiden, eindimensionale Figuren hinzustellen, die es einem zu leicht machen, sich von ihnen zu distanzieren.

Letztendlich muss jeder für sich entscheiden, wofür man stehen will.
Andreas Dresen: Wo stehe ich? Wofür stehe ich? Wo fängt der eigene kleine Opportunismus an? Denn eines ist klar: Diktaturen werden nicht nur von den Schreihälsen getragen. Sie werden überwiegend getragen von der großen schweigenden Masse, die vielleicht nicht einverstanden ist mit den Verhältnissen, sich aber aus unterschiedlichen Gründen nicht traut, den Mund aufzumachen. Wie schnell ist man dabei? Schon das Gespräch mit dem Chef kann ja schwierig sein, wenn man sich überlegen muss, welche Nachteile es haben könnte, wenn man dies oder jenes sagt. Jeder wird in seinem Alltag Beispiele dafür finden. Da fängt es an. Und endet dann in den großen politischen Fragen unserer Zeit. Deshalb ist es interessant, sich auf der Leinwand diese Menschen anzusehen, die so tapfer waren in schwierigen Zeiten, und sich selber zu hinterfragen.
Auch Ihre leichten Filme sind stets politisch, weil Sie immer eine klare Haltung zeigen, zu den Menschen, zu ihrem Umgang miteinander. Was stellt die aktuelle Entwicklung mit Ihnen als Künstler und Filmemacher an? Was werden Sie als Nächstes machen?
Andreas Dresen: Ich verhalte mich in der Wahl meiner Stoffe nicht tagesaktuell. Filme müssen auch in 10 oder 20 Jahren noch eine Nachricht haben und in anderen Regionen dieser Welt. Ich hätte durchaus Lust, wieder mal etwas Leichteres zu machen. Die letzten drei Filme waren ganz schöne Brocken. Vielleicht wird es etwas Kleineres, Positiveres. Mir gefällt die Idee, endlich wieder einen Gegenwartsfilm zu machen nach all den dramatischen und historischen Filmen – selbst „Rabiye Kurnaz“ war auf seine Weise ja ein historischer Film. Ich merke einfach, dass die Arbeit an Produktionen wie „Hilde“ extrem kräftezehrend ist und einen ganz schön in Abgründe stößt.
Das Gespräch führte Thomas Schultze.