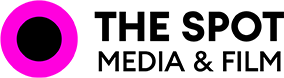Eigenwillig-faszinierendes Endzeit-Musical über eine Gemeinschaft von sechs Menschen, die den Untergang der Zivilisation in einem Bunker unter der Erde überlebt hat.

FAST FACTS:
• Originalität ist Trumpf: ein Arthouse-Musical vom und über das Ende der Welt
• Starke Besetzung mit Tilda Swinton, Michael Shannon, George MacKay und Moses Ingram
• Erste Spielfilmarbeit des gefeierten Dokumentarfilmemachers Joshua Oppenheimer
• Weltpremiere in Telluride, im Anschluss in Toronto und San Sebastián
CREDITS:
Land / Jahr: Dänemark, Irland, Deutschland, Italien, UK, USA, Schweden 2024; Laufzeit: 148 Minuten; Regie: Joshua Oppenheimer; Drehbuch: Joshua Oppenheimer, Rasmus Heisterberg; Besetzung: Tilda Swinton, Michael Shannon, George MacKay, Moses Ingram, Bronagh Gallagher, Lennie James, Tim McInnerney
REVIEW:
Für Menschen, die glauben im Kino wirklich alles schon gesehen zu haben, ist 2024 ein echter Augenöffner – Geschichten über mexikanische Drogenbarone, die Frauen sein wollen, das Leben der Familie Höß als Homestory, die Lebensgeschichte von Robbie Williams, der von einem Affen gespielt wird, und die Lebensgeschichte von Pharrell Williams mit Lego nachgestellt. Und jetzt, tada, ein Musical über das Ende der Welt. Oder besser: über die Familie, die das Ende der Welt mitverschuldet hat und nun zu sechst seit 20 Jahren in einem Bunker in einer Salzmine weit unter der Erde haust. Von Joshua Oppenheimer in seinem Debüt als Spielfilmregisseur, der legendäre Dokumentarfilmer, dem es für „The Act of Killing“ gelungen war, Mitglieder indonesischer Todesschwadronen ihre Taten in nachgestellten Filmszenen durchspielen zu lassen. Wenn man so will, ist es von dort nur ein kleiner Schritt zu „The End“, der auf oft faszinierende, bisweilen irritierende Weise eines der Lieblingsthemen Oppenheimers durchspielt: Wie wir mit Schuld umgehen, sie rationalisieren oder in ferne Ecken unseres Verstandes verbannen, ohne sie jemals verarbeiten zu können.
Der Film beginnt da, wo alle anderen Filme enden: mit der Einblendung „The End“, auf die ein Zitat aus T.S. Elliots „Das wüste Land“ folgt. Dieses „Wasteland“ indes bekommt der Zuschauer nie zu sehen: Die Feuer, die die Erde zerstört haben, lodern oben, machen Leben unmöglich. „The End“ aber begibt sich in den Untergrund, wie das schon die deutsche Punkband Toxoplasma vor 40 Jahren so treffend beschrieben hat in ihrem Song „Bunkerparty“: „Da unten wird gefeiert und hier oben krepiert der Rest“. Wobei der vordere Teil hier nicht ganz zutreffend ist: In dem weitläufigen Bunkerarreal, in dem man sich eingerichtet hat mit den schicksten Möbeln und Designgegenständen, die man für Geld kaufen kann, lebt die namenlose Familie (Vater, Mutter, Sohn) mit ihren drei Angestellten in selbstvergessener Ignoranz: So gut man kann, wird die Realität verdrängt. Es ist, als wolle man dem Sohn in seinen Zwanzigern, für den es kein anderes Leben als das tief unter der Erde gibt, der noch nie das Meer gesehen hat, den Himmel, fliegende Vögel, die bittere Pille so schmackhaft wie möglich machen. Und hat es sich auf diese Weise bequem eingerichtet, die eigenen Verfehlungen von einst zu verdrängen und sich eine geschönte Biographie zu verschaffen: Wer sollte jemals anzweifeln können, dass Mutter eine Ballerina im Bolshoi-Theater war?
Die Welt ist fake. Da ist es naheliegend, von ihr in Form des fakesten aller Filmgenres zu erzählen, dem Musical, ausgedacht, behauptet, inszeniert. Das funktioniert ausgesprochen gut, vielleicht auch, weil die Schauspieler gerade keine ausgebildeten Singstimmen haben. Da unten im Bunker muss man mit dem auskommen, was man hat, richtig? Und doch machen Tilda Swinton, Michael Shannon und George MacKay in den Hauptrollen, unterstützt von Bronagh Gallagher, Lennie James und Tim McInnerney (als Köchin, Hausarzt und Diener), ihre Sache sehr gut. Vielleicht auch, weil die Lieder, komponiert von Joshua Schmidt in seiner ersten Filmarbeit, basierend auf Texten von Joshua Oppenheimer, der auch das Drehbuch mit dem dänischen Profi Rasmus Heisterberg schrieb, so passgenau sind, einerseits einen ganz klassischen Sondheim-Touch haben, mit ihrer melancholischen Stimmung aber auch einen Nerv treffen. Das ist besonders so, wenn die Lieder nicht einfach nur den Dialog übernehmen, sondern als Choreographien den gesamten Raum einnehmen, aus dem Wohnbereich mit seiner Vielzahl von klassischen Gemälden großer Meister übersprudeln in den beklemmenden Minenbereich mit seinen höhlenartigen Gängen (inklusive denkwürdigem Furzmoment).
Dass dies ein Ort ist, an dem man nicht nur sich selbst, sondern die gesamte Geschichte der Menschheit neu erfinden kann, wird schnell deutlich: Der Vater lässt sich von seinem Sohn eine Biographie schreiben, die er sich mehr oder weniger frei ausdenken kann, weil die Erinnerung des Patriarchen an den entscheidenden Stellen streikt. Der Sohn wiederum arbeitet emsig an einem Modell des Amerika der Vergangenheit, in dem unter dem Hollywoodschild in stiller Eintracht und friedvoller Zufriedenheit Schwarze Sklaven und chinesische Arbeiter, die die Eisenbahn in den Westen gebaut haben, wohnen. Der systemische Selbstbetrug, der bei den Bewohnern zu Depressionen und Albträumen führt, kann indes nicht länger aufrechterhalten werden, als „Mädchen“, gespielt von Moses Ingram aus „Lady in the Lake“, in die traute Gemeinschaft platzt. Sie hat sich den Weg aus der Hölle auf Erden in die friedvolle Trutzburg gebahnt und ist nun der Katalysator für einen Moment der Erkenntnis und Abrechnung. Die Koproduktion von sieben Ländern (von deutscher Seite ist The Match Factory an Bord) erzählt sich in eher unhandlichen knapp 150 Minuten Laufzeit durchaus als Herausforderung für das Publikum, hat aber die nötigen Schauwerte, starke Schauspieler und nicht zuletzt tolle Musiknummern, um die nötige Aufmerksamkeit zu wecken. Und ein Musical vom Ende der Welt? Wie oft hat man das schon?
Thomas Schultze