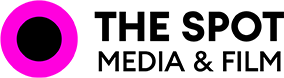Verfilmung einer Graphic Novel von Camille Jourdy, in der eine Kinderbuchillustratorin für zwei Wochen in ihren Heimatort in der französischen Provinz reist.
FAST FACTS:
• Französische Ensemble-Komödie über familiäre Beziehungen und alltägliche Dramen in der Provinz
• Nach „Rosalie Blum“ die zweite Verfilmung einer Graphic Novel von Camille Jourdy
• Authentisch, liebevoll, berührend inszeniert von Blandine Lenoir („Annie Zorn“, „Madame Aurora und der Duft von Frühling“)
CREDITS:
O-Titel: Juliette au printemps; Land/Jahr: Frankreich, 2024; Laufzeit: 106 Minuten; Regie: Blandine Lenoir; Drehbuch: Maud Ameline, Camille Jourdy, Blandine Lenoir; Besetzung: Izïa Higelin, Jean-Pierre Darroussin, Sophie Guillemin, Noémie Lvovsky, Liliane Rovère, Salif Cissé, Thomas de Pourquery, Éric Caravaca; Verleih: Pandora Filmverleih; Start: 18. Juli 2024
REVIEW:
Juliette, Kinderbuchillustratorin aus Paris, reist mit dem Zug für zwei Wochen in ihren Heimatort in der französischen Provinz. Hier ist irgendwie alles beim Alten, und doch hat sich vieles verändert. Das Gedächtnis ihres Vaters ist nicht mehr ganz auf der Höhe. Die geschiedene Mutter hat mal wieder einen neuen Freund und malt esoterische Aktbilder. Der älteren Schwester Marylou wachsen Haushalt, Ehemann, Kinder und ihr mobiler Haarsalon über den Kopf, und die Affäre mit dem ortsansässigen Kostümverleiher macht die Sache nicht einfacher. Außerdem muss die Wohnung der geliebten Oma aufgelöst werden, die ins Seniorenheim umgezogen ist. Juliette selbst leidet unter Panikattacken, Schlaflosigkeit und Depressionen, sie fühlt sich wie in einer anderen, „tragischen“ Dimension, wie es der verständnisvolle Pollux nennt, mit dem sie sich anfreundet. Er wohnt jetzt im Haus der Großmutter und ist der einzige, mit dem sie wirklich reden kann. Vor allem ist es unmöglich, mit ihrem meist etwas unaufmerksamen Vater ein richtiges Gespräch zu führen, irgendetwas steht immer zwischen ihnen. Als Juliette eine Kiste mit Erinnerungsstücken aus ihrer Kindheit öffnet, ist das wie die Büchse der Pandora, die einen Geist aus der Vergangenheit zum Vorschein bringt.

„Juliette im Frühling“ ist nach „Rosalie Blum“ bereits die zweite Verfilmung einer Graphic Novel von Camille Jourdy. In ihren kindlich-naiv gezeichneten Erwachsenencomics verknüpft die preisgekrönte Autorin und Illustratorin mit großem Detail- und Figurenreichtum Komödie, Tragödie und Charakterstudie – und liefert damit den perfekten Stoff für typisch französisches Wohlfühlkino. So erfindet dann auch Blandine Lenoirs herzerwärmende Leinwandadaption das Genre nicht neu, entfaltet aber einen ganz eigenen, verspielt- melancholischen Charme – und einen bestechend hohen Wiedererkennungswert. Wie in ihrer vergnüglichen Wechseljahrekomödie „Madame Aurora und der Duft von Frühling“ beschäftigt sich Lenoir erneut mit der Frage, wie man bzw. Frau mit dem Älterwerden zurechtkommt oder nicht, fast nebenbei werden Themen wie psychische Gesundheit, Demenz und Trauerbewältigung mit unaufgeregter Selbstverständlichkeit angesprochen.
Die Regisseurin hat einen respektvollen und zärtlichen Blick für ihre komplexen, widersprüchlichen, eben sehr echten Charaktere. Sie lenkt die Aufmerksamkeit immer wieder auf die kleinen Dinge, die sich dann auch in den Zeichnungen ihrer Hauptfigur wiederfinden – die neue Falte auf der Stirn ihres Vaters, die Gegenstände und Tapete im ehemaligen Kinderzimmer, das verstoßene Entenküken Norbert, das Pollux und Juliette im Gras finden und adoptieren. Juliette kann sich besser auf dem Papier ausdrücken als mit Worten, die ihr manchmal einfach entfallen. Die Dialoge enden dementsprechend oft mit einem abrupten Schnitt, und sind so authentisch, als hätte sie das Leben selbst geschrieben. Juliettes Gespräche mit dem Vater beschränken sich auf das Mittagessen, die dauergestresste Marylou verdreht die Augen, sobald ihre Schwester ihre gesundheitlichen Probleme erwähnt, bei einer Geburtstagsfeier reden alle aneinander vorbei und werden sich nicht einmal darüber einig, ob das Gratin versalzen ist. Die Familiendynamik, das schwesterliche Gezanke, das kindische Geplänkel der geschiedenen Eltern – alles ist schmerzhaft gut beobachtet. Alle haben ihre eigene Meinung und ihre eigene Lebensrealität, alle haben ihre Ticks und neigen zur Depression, selbst die Katze, die sich ständig todesmutig vom Dach stürzt.
Das gesamte Ensemble von Noémie Lvovsky, („Rosalie Blum“) als exzentrische Mutter auf dem Eso-Trip bis zu Filmlegende Liliane Rovère („Call My Agent“) als leicht demente Oma Simone ist superb, aber es ist vor allem Jean-Pierre Darroussin, der als personifizierter Provinzalltag mit Schnauzbart, Jacquardpullover und launischem Humor für tragikomische Momente sorgt. In der Titelrolle ist die Schauspielerin und Rocksängerin Izïa Higelin genauso genial besetzt wie der französische Jazzmusiker Thomas de Pourquery („Saint Omer“) als Marylous Liebhaber, der wahre Screwball-Qualitäten an den Tag legt. Die Sexszenen mit der ebenso tollen Sophie Guillemin, in denen er sich unter anderem in einem Braunbärkostüm im Garten an sie heranpirscht, bevor beide Venuskörper hemmungslos und etwas albern zwischen Pflanztöpfen herumwälzen, sind eine Offenbarung. Höhepunkt des Films aber ist die so irrwitzige wie herzzerreißende Sequenz, in der sich die Ereignisse zumindest für Kleinstadtverhältnisse dramatisch zuspitzen, tatsächlich ein Gespenst auftaucht, Marylous Leben aus dem Ruder und Oma davonläuft, eine Ente unter die Räder und eine Tragödie ans Licht kommt. Oft muss eben erst ein kleineres oder größeres Unglück passieren, damit man wieder weiß, wofür man eine Familie hat. Auch, wenn man am Ende (lieber) wieder allein im Zug sitzt.
Corinna Götz