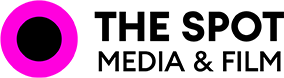Sieben Oscars für „Oppenheimer“: Erstmals seit „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ vor 20 Jahren konnte wieder ein Blockbuster bei den Academy Awards abräumen, der erste Studiofilm seit „No Country for Old Men“, der als bester Film ausgezeichnet wurde. Die große Überraschung: Emma Stone setzte sich gegen Lily Gladstone durch und gewann ihre zweite Statue als beste Hauptdarstellerin.

Gut gemacht, Oscar! Nachdem im Vorfeld der 96. Academy Awards wie in den Jahren davor reflexartig lange darüber diskutiert worden war, dass eine Veranstaltung wie die Oscars längst von der Zeit überholt und nicht mehr maßgeblich seien, bedurfte es nur einer schönen Veranstaltung wie der zum vierten Mal von Jimmy Kimmel moderierten Gala, um die ewigen Nörgler und Schlechtreder in die Schranken zu weisen. Natürlich hatten die Oscars in diesem Jahr auch die richtigen Filme und Namen im Angebot, um punkten zu können. Auf geradezu geniale Weise vereinten und versöhnten die 23 vergebenen Preise das klassische Hollywood mit einer Filmindustrie im Umbruch und Aufbruch, wurde erstmals seit 2008 wieder eine Studioproduktion als bester Film bedacht und konnte erstmals seit 2003 wieder ein waschechter Blockbuster die Veranstaltung dominieren (und in diesem Fall sieben Preise gewinnen). Natürlich hatte man mit „Oppenheimer“ auch den richtigen Film zum Auszeichnen parat – ein klassisches Biopic-Epos vom Format eines „Gandhi“ oder „Amadeus“, eine Produktion wie gemacht für einen Preisregen: handwerklich und künstlerisch überragend, in allen Belangen ambitioniert und trotz einer Laufzeit von 180 Minuten auch noch weltweit an den Kinokassen erfolgreich mit einem Einspiel von 960 Millionen Dollar.

Die Auszeichnung von „Oppenheimer“-Schöpfer Christopher Nolan als bester Regisseur war überfällig: Fünfmal wurde der 53-jährige Brite bereits nominiert, keiner hat sich in den letzten Jahren vehementer für das Erlebnis Kino eingesetzt als er. „Wir haben einen Film gemacht über den Mann, der die Atombombe erschaffen hat, und ob es uns gefällt oder nicht, wir alle leben in Oppenheimers Welt“, sagte Nolan in seiner gewohnt eloquenten und bewegenden Rede. Der Mann hat Klasse. Und sorgte mit „Oppenheimer“ dafür, dass die erstaunliche Karriere von Robert Downey Jr. wieder in eine neue Phase eintritt: vom vielversprechenden Jungstar über abgestürztes Drogenwrack, das nicht mehr vermittelbar war, und erfolgreichsten Star der Welt, auf dessen Rücken das Marvel-Imperium gebaut wurde, hin zum virtuosen Künstler, ein Vollblutschauspieler durch und durch. Und natürlich ist „Oppenheimer“ auch dafür verantwortlich, dass der vormals stets zuverlässige und faszinierende irische Charakterschauspieler Cillian Murphy zum Star werden konnte – und bei den Oscars das Kopf-an-Kopf-Rennen mit Paul Giamatti als bester Darsteller für sich entschied. Weitere „Oppenheimer“-Preise gingen an die beste Kamera, den besten Schnitt und die beste Musik.

Nachdem in den vergangenen Jahren, beginnend mit dem koreanischen Cannes-Gewinner „Parasite“, eher Oscar-untypische Filme die Veranstaltung dominieren konnten (die Bester-Film-Gewinner seit 2020 sind „Nomadland“, „CODA“ und „Everything Everywhere All At Once“), wirkte es regelrecht ungewöhnlich und erfrischend, dass nun wieder ein eher konventioneller Publikums- und Prestigefilm – einst die große Stärke Hollywood – gewinnen konnte. Von wegen, Hollywood sei vom Woke-Virus befallen: „Oppenheimer“ ist aus nachvollziehbaren Gründen kein Paradebeispiel für eine diverse Produktion, und doch gab es kein Murren: Seit dem Kinostart im Juli stand fest, dass Christopher Nolans Ausnahmeproduktion der Film sein würde, den man auf dem Weg zur Statue schlagen müsste. Wie nahe vielleicht „Poor Things“, „The Zone of Interest“ oder „Killers of the Flower Moon“ als stärkste Konkurrenten gekommen sein mögen, dem Triumphator die Krone streitig zu machen, wird man nie erfahren. Es spielt auch keine Rolle: Der Favorit hat sich durchgesetzt. Und das wohl auch zurecht.

Gleichzeitig war es eben doch keine Oscarveranstaltung wie in den guten alten Tagen. Weil zwar eine klassische Studioproduktion die Preisvergabe dominierte wie einst, aber viele der weiteren Preise in dieser massierten Form noch vor zehn Jahren wohl eher undenkbar gewesen wären. So waren zwei japanische Filme erfolgreich – „Der Junge und der Reiher“ als bester Animationsfilm (durchaus überraschend: „Spider-Man: Across the Spiderverse“ war ein starker Gegenkandidat, der auch als Favorit gegolten hatte) und „Godzilla Minus One“ für die besten visuellen Effekte. Justine Triet und ihr Schreibpartner Arthur Harari konnten für „Anatomie eines Falls“ die Auszeichnung für das beste adaptierte Drehbuch entgegennehmen – eine knallende Ohrfeige für das französische Oscar-Auswahlkomitee, das den Cannes-Gewinner für nicht stark genug für die Kategorie „Internationaler Spielfilm“ befunden und stattdessen (den wunderbaren) „Geliebte Köchin“ ins Rennen geschickt hatte, nur um dann nicht nominiert zu werden, während „Anatomie eines Falls“ es auf fünf Nominierungen schaffte, unter anderem als bester Film, für die beste Regie und die beste Darstellerin (Sandra Hüller). Das Rennen um den internationalen Film wäre dann deutlich spannender gewesen.

Ohne Ilker Çataks (wunderbaren) „Das Lehrerzimmer“ oder Wim Wenders‘ (wunderbaren, für Japan gestarteten) „Perfect Days“ kleinreden zu wollen, aber „The Zone of Interest“ (immerhin mit Sandra Hüller und Christoph Friedel in den Hauptrollen und fast komplett in deutscher Sprache gedreht) war hier der klare Favorit – und dann auch der erste britische Film, der in dieser Kategorie gewinnen konnte. Auch zwei schwarze Künstler wurden mit Oscars bedacht: Da’Vine Joy Randolph als beste Nebendarstellerin für „The Holdovers“ (grandiose Dankesrede, gleich zu Beginn der Preisvergabe) und Cord Jefferson für „American Fiction“ für das beste adaptierte Drehbuch – kurioserweise vergaß er bei seiner Rede, dem Autor der Vorlage, Everett Percival, zu danken. Beide waren die Favoriten in ihren jeweiligen Kategorien gewesen.

Kommen wir zur größten Überraschung des Abends (klammert man einmal den Oscar von „The Zone of Interest“ für den besten Ton aus – hier hatte „Oppenheimer“ als Favorit gegolten): Emma Stone gewann für ihre Darstellung in dem insgesamt vierfach prämierten (und damit zweitstärksten Titel des Abends) Venedig-Gewinner „Poor Things“ ihren zweiten Oscar als beste Schauspielerin (nach „La La Land“ im Jahr 2016) und setzte sich damit gegen Lily Gladstone aus „Killers of the Flower Moon“ durch, die zuletzt durch Gewinne bei den SAG Awards wieder Oberwasser gewonnen hatte. Das Narrativ wäre klassisch Oscar, klassisch emotional gewesen. Gladstone war die erste indigene Schauspielerin, die in dieser Kategorie für einen Academy Awards nominiert wurde und wäre entsprechend auch die erste indigene Siegerin gewesen. Aber nachdem sie gar nicht erst für einen BAFTA Award nominiert wurde, kristallisierte sich wohl heraus, dass sie nicht unbedingt auf Academy-Mitglieder aus dem Ausland würde bauen können. Und während wie, wie der SAG Award vermittelt, zwar die amerikanischen Schauspielern auf ihrer Seite hatte, legten drei technische Preise für „Poor Things“, insbesondere bestes Maskenbild nahe, dass Emma Stone zusätzlich auf die Unterstützung der Gewerke bauen konnte. Objektiv betrachtet, ist ihre Darstellung auch eine Hauptrolle durch und durch. Als Bella Baxter ist sie fast in jeder Szene des Films von Yorgos Lanthimos, ohne sie ist er nicht denkbar. Lily Gladstone hingegen ist zwar stark in „Killers of the Flower Moon“, aber doch zu sehr abhängig von den männlichen Schauspielern an ihrer Seite. Halten wir fest, dass es ein strategischer Fehler von Apple war, sie ins Rennen um die beste weibliche Hauptrolle zu schicken. Ihre Siegeschancen wären als beste Nebendarstellerin deutlich höher gewesen, auch wenn sich in diesem Feld Da’vine Joy Randolph als formidable Konkurrentin erwiesen hätte.

Überhaupt „Killers of the Flower Moon”, überhaupt Streamer – die großen Verlierer des Abends, die, man höre und staune, komplett leer ausgegangen wären, wenn sich nicht Netflix einen Oscar für den besten Kurzfilm gesichert hätte: „Ich sehe was, was du nicht siehst“ nach einer Vorlage von Roald Dahl bedeutete zugleich auch den ersten Academy Award für Wes Anderson. Martin Scorsese, 2006 siegereich mit „The Departed – Unter Feinden“, hatte es zuletzt schon bei „The Irishman“ bei zehn Nominierungen auf null Oscars gebracht und musste in diesem Jahr ein identisches Debakel hinnehmen. „Killers“ ist ein starker Film, aber dann doch wohl eher nur bei den Gebrechlicheren in der Academy ein echter Favorit. Die Konkurrenz war einfach zu stark. Aber nicht nur Apple musste sich geschlagen geben, auch Netflix machte in diesem Jahr keinen Stich: Zumindest auf einen Preis für das beste Maskenbild für „Maestro“ hatte man hoffen dürfen. Da kam allerdings „Poor Things“ dazwischen und öffnet damit dem Sieg von Emma Stone Tür und Tor. Wenn es unter den Studiofilmen einen Verlierer gab, dann war das „Barbie“, der an den Kinokassen erfolgreichste Film des vergangenen Jahres, der es bei acht Nominierungen auf eine einzige Statue brachte – für den besten Song, der bereits zweite Oscar für Popsuperstar Billie Eilish (das Publikum hätte sich eher über „I’m Just Ken“ gefreut – Ryan Goslings Vortrag auf der Bühne zählte zu den Highlights).

Die aus Deutschland angereiste Equipe blieb zwar ohne Preise, gehörte aber nicht zu den Verlierern. Im Gegenteil. Wie Ilker Çatak, Ingo Fliess, Sandra Hüller und Wim Wenders in Hollywood für den deutschen Film warben, macht sie zu echten Botschaftern für ein neues Selbstverständnis unter deutschen Filmemachern, aber auch ein neues Selbstbewusstsein. Insbesondere „Das Lehrerzimmer“ flogen die Herzen zu, der Deutsche-Filmpreis-Gewinner, der nicht gut genug für den Berlinale-Wettbewerb gewesen war. Unterstützt von der Oscar-Power des erfahrenen US-Verleihs Sony Pictures Classics, die sich die amerikanischen Rechte an der Produktion von Ingo Fliess unmittelbar nach der Weltpremiere im Panorama der Berlinale gesichert hatten, war die amerikanische Presse voll des überschwänglichen Lobs für den Film. Es war also auch ein denkbar gutes Event für den deutschen Film – bei German Films kann man sich jedenfalls freuen.

Die 96. Academy Awards waren eine Veranstaltung, die in einem aufgeheizten Umfeld stattfanden: Der amerikanische Wahlkampf wirft bereits seinen Schatten voraus. Die Kriege in der Ukraine und in Gaza waren weitere Themen, die sich nicht ausblenden ließen. Und doch war es, trotz zahlreicher politischer Statements in den Dankesreden, speziell die in den sozialen Medien beschämend verdreht und fehlinterpretiert wiedergegebene Dankesrede von Jonathan Glazer, und nicht zuletzt der Auszeichnung von „20 Days in Mariupol“ als besten Dokumentarfilm, die erste ukrainische Produktion, die einen Oscar gewinnen konnte, eine beschwingte, milde Veranstaltung – dringend nötiges Seelenbalsam für eine Branche, die ein hartes Jahr hinter sich hat. Entsprechend war Jimmy Kimmel ein idealer Conferencier, dem man gelungene, aber nicht allzu bissige Gags geschrieben hatte. Erst ganz zum Schluss teilte er aus, als er einen bizarren Tweet von Donald J. Trump vorlas, den er auf Truth Social abgesetzt hatte und in dem er auf gewohnt plumpe Weise versuchte, Kimmel zu verhöhnen. Kimmel freute sich sichtlich über die Steilvorlage, zeigte sich verblüfft darüber, dass sich der ehemalige Präsident so viel Zeit genommen habe, die ganze Gala anzusehen und sagte dann den Satz des Abends: „Isn’t it way past your jail time?“
Thomas Schultze
Die 96. Academy Awards im Überblick
Alle Gewinner
Alle Gewinner
Bester Film
„Oppenheimer“
Beste Regie
Christopher Nolan („Oppenheimer“)
Bester Darsteller
Cillian Murphy („Oppenheimer“)
Beste Darstellerin
Emma Stone („Poor Things“)
Bester Nebendarsteller
Robert Downey Jr. („Oppenheimer“)
Beste Nebendarstellerin
Da’Vine Joy Randolph („The Holdovers“)
Bestes Originaldrehbuch
Justine Triet, Arthur Harari („Anatomie eines Falls“)
Bestes adaptiertes Drehbuch
Cord Jefferson („American Fiction“)
Beste Kamera
Hoyte van Hoytema („Oppenheimer“)
Bester Schnitt
Jennifer Lame („Oppenheimer“)
Bestes Kostümbild
Holly Waddington („Poor Things“)
Bestes Szenenbild
James Price, Shona Heath, Zsuzsa Mihalek („Poor Things“)
Bestes Maskenbild
Nadia Stacey, Mark Coulier, Josh Weston („Poor Things“)
Bester Ton
Tarn Willers, Johnnie Burn („The Zone of Interest“)
Beste visuelle Effekte
Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi, Tatsuji Nojima („Godzilla Minus One“)
Beste Musik
Ludwig Göransson („Oppenheimer“)
Bester Originalsong
„What Was I Made For?“ von Billie Eilish und Finneas O’Connell („Barbie“)
Bester Animationsfilm
„Der Junge und der Reiher“
Bester internationaler Film
„The Zone of Interest“
Bester Dokumentarfilm
„20 Days in Mariupol“
Bester Dokumentarkurzfilm
„The Last Repair Shop“
Bester Kurzfilm
„The Wonderful Story of Henry Sugar“
Bester animierter Kurzfilm
„The War Is Over“