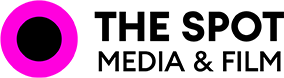Nach der Deutschlandpremiere beim 41. Filmfest München kommt „Ezra – Eine Familiengeschichte“ jetzt am Donnerstag im Verleih der Tobis in die deutschen Kinos. Wir haben uns mit Regisseur Tony Goldwyn darüber unterhalten, warum sein Film früher bei einem Studio gelandet wäre und wie sich die Industrie verändert hat.

„Ezra – Eine Familiengeschichte“ erinnert an eine gute Hollywood-Tradition, die verloren gegangen scheint: charaktergetriebene Geschichten über nachvollziehbare Menschen mit echten Sorgen und Nöten. Wie ist es Ihnen gelungen, das Projekt auf die Beine zu stellen?
Tony Goldwyn: Früher waren Filme wie meiner einmal eines der Standbeine Hollywoods, ein wichtiger Bestandteil des Portfolios der Studios. Die Blütezeit dafür waren die späten Sechziger- und Siebzigerjahre, aber diese Filme wurden bis in die späten Neunzigerjahre wie selbstverständlich gemacht. Das Problem waren die explodierenden Vermarktungskosten, dass die Studios für diese mit überschaubaren Budgets entstandenen Filme so viel Geld für Werbung ausgeben mussten, dass jede Verhältnismäßigkeit verloren wurde. Heute kommen für die Studios nur noch Stoffe in Frage, die ganz klar zu vermarkten sind, bei denen die Risiken überschaubar sind. Filme wie meiner müssen unabhängig finanziert werden; Studios kaufen sie dann vielleicht, wenn sie fertig sind und sie eine Vorstellung haben, was sie da genau vermarkten.
Aber eine Garantie hat man nicht, dass ein Studio anbeißt.
Tony Goldwyn: „Ezra“ wurde von Bleecker Street in die US-Kinos gebracht, auch sonst haben wir den Film in die wichtigen Territorien an Independents verkauft. In den USA hatten wir dann einen kleinen Kinostart mit guten Zahlen, nachdem wir den Film in einer Reihe von Festivals gezeigt hatten. Danach kam sehr schnell die Auswertung als PVoD und im Streaming. Das war gut. Aber man darf auch nicht vergessen, dass wir einen namhaften Cast hatten: Bobby Cannavale, Rose Byrne, Robert De Niro. Früher wäre ein Film wie „Ezra“ ziemlich sicher bei einem Studio gelandet. Die gesamte Landschaft hat sich radikal verändert, heute funktionieren einfach andere Modelle. In den Neunzigerjahren wäre uns für einen Film wie diesen um die 20 bis 25 Millionen Dollar zur Verfügung gestanden. Wir haben ihn heute für rund zehn Mio. Dollar gemacht. Aber das Verrückte ist: Das Bedürfnis des Publikums hat sich nicht wirklich verändert. Die Menschen wollen Filme wie „Ezra“ unverändert sehen. Vielleicht haben sie kein langes Leben im Kino, aber sie laufen im Anschluss sehr gut im Streaming. Unser Film spielt zwar weniger Geld ein, aber wird von mehr Menschen gesehen, als er früher der Fall war.

Würden Sie sagen, dass die Veränderungen in der Produktion und Auswertung der Filme auch Ihren Job als Filmemacher verändert haben? Kann man heutzutage bei einem Stoff wie „Ezra“ überhaupt NUR Regisseur sein?
Tony Goldwyn: Ich bin ein Produzent, weil ich ein Produzent sein muss, nicht weil es mir im Blut liegt oder ich ein Produzent sein will. „Ezra“ ist ein gutes Beispiel, weil das ein Film ist, den ich von Anfang unter meinen Fittichen hatte. Das Drehbuch wurde von einem meiner besten Freunde geschrieben, Tony Spiridakis, mit dem ich seit mehr als 40 Jahren befreundet bin und der seine eigenen Erfahrungen mit einem autistischen Sohn – dessen Pate ich bin – verarbeitet hat. Ich habe bei der Entwicklung des Buchs geholfen, habe den Cast versammelt, habe die ursprüngliche Finanzierung in die Wege geleitet. Als wir dann Robert De Niro an Bord hatten, änderte sich die Gemengelage. Bobs Agent, den ich ebenfalls schon sehr lange kenne, sagte zu mir: Tony, du machst einen prima Job, aber jetzt nimmt das Projekt eine Größe an, dass du einen richtigen Produzenten als Partner gewinnen musst. So kamen dann mit Bill Horberg und Jon Kilik zwei Produzenten an Bord, die mit allen Wassern gewaschen sind, zwei richtige Produzenten eben, was es mir dann ermöglichte, mich verstärkt auf meine Arbeit als Regisseur zu konzentrieren, auf die kreative Seite. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir ein paar Auslandsrechte verkauft, um grundsätzlich schon einmal starten zu können. Aber sie haben dann die eigentliche Arbeit gemacht.
Klingt anstrengend.
Tony Goldwyn: Die Zeiten, in denen mir Produzenten mit guten Studiodeals über meinen Regie-Agenten Drehbücher für finanzierte Stoffe zukommen ließen und mich als Regisseur gewinnen wollten, sind leider vorbei. Das gibt es nur noch im Fernsehen, bei Serien. Ich arbeite gerne als Regisseur. Wenn man aber Kino machen will, dann darf man nicht warten. Dann muss man aktiv werden und sich hinter die Sache klemmen. Dass es im Fall von „Ezra“ so gut funktioniert hat, ist sehr beglückend für mich, einfach, weil es ein so persönlicher Stoff ist.
Für das Kino sind Sie also ein anderer Regisseur, als wenn sie Serien machen?
Tony Goldwyn: Das ist eine zutreffende Betrachtung. Im Fernsehen bin ich primär Regisseur. Eine Serie, die ich als Produzent begleitet habe, wurde dann auch umgesetzt. Viele andere sind im Sand verlaufen. Ich denke, dass man die heutigen Abläufe im Fernsehen mit dem alten Studiosystem vergleichen kann, wo man als Kreativer eine Festanstellung hatte und dann von einem Projekt zum nächsten vermittelt wurde. Man ist Teil einer gut geölten Maschine und trägt zum Gelingen der Produktionen bei. Im Fernsehen ist der Kreative, bei dem die Fäden zusammenlaufen, der Showrunner. Er ist der eigentliche Schöpfer. Als Regisseur bin ich sein Weggefährte. Wenn man mit einer Shonda Rimes arbeitet, setzt man ihre Vision um. Im Kino ist das anders. Als Regisseur eines Kinofilms hat man einen anderen Job. Natürlich arbeitet man auch da eng und auf Augenhöhe mit dem Drehbuchautor. Aber wenn das Drehbuch fertig ist, laufen die Fäden beim Regisseur zusammen, dann werden die kreativen Entscheidungen von ihm getroffen. Für mich ist es selbstverständlich, dass meine Autoren für die Dauer einer Produktion meine siamesischen Zwillinge sind. Aber meine Entscheidungen sind es, die endgültig sind.
Kino ist also eine persönlichere Angelegenheit?
Tony Goldwyn: Unbedingt. Kino ist mir ein Anliegen. Deshalb ist man auch bereit, einen größeren Leidensweg zu gehen. Als Regisseur trägt man Verantwortung. Eine Verantwortung, die ich gerne trage und zu tragen bereits bin. Im Umkehrschluss sehe ich einen Kinofilm als eine Form von persönlichem Ausdruck an. Da geht es um etwas. Oder besser gesagt: Da geht es um Dinge des Herzens – und nicht nur eine bestmögliche Umsetzung.
Wie „Ezra“…
Tony Goldwyn: Bei „Ezra“ war ich sehr berührt von der Idee, Autismus als eine Metapher dafür anzusehen, was wir alle erleben, besonders als Eltern, aber auch in allen anderen Aspekten des Lebens: Wir haben den Eindruck, uns dem gesellschaftlichen Druck zu beugen, dass unsere Kinder Leistung bringen müssen, um dazuzugehören und erfolgreich zu sein. Die Wahrheit ist genau das Gegenteil: Wir sollten diesen Druck nicht an unsere Kinder weitergeben, sondern sie nach ihren Fähigkeiten und Talenten fördern. Unsere Superkraft sind die Dinge, die uns abheben und anders sein lassen, nicht Konformität und Anpassung. Das macht uns stark. Das sehe ich Elternteil so, aber auch sonst im Leben: Nehmen wir die Menschen, wie sie sind – wir alle wachsen daran.
Das Gespräch führte Thomas Schultze.